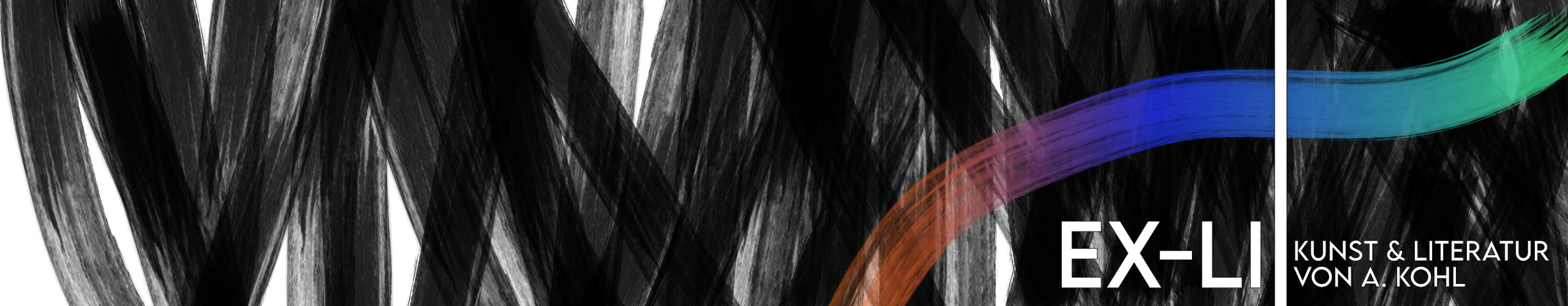Zusätzlich zur Hauptgeschichte hatte ich mich entschlossen, zu jedem wichtigen Charakter der Gruppe ein Spezialkapitel zu verfassen, in dem noch einmal die Vergangenheit des Charakters, anhand eines prägenden Ereignisses erläutert wird.
Klicke auf die Icons um zum jeweiligen Spezialkapitel zu gelangen:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 Spezialkapitel R – Mondschein und Schwerthieb
Spezialkapitel R – Mondschein und Schwerthieb
Es war ein schöner, warmer Sommertag, als ein kleiner Junge mit langen schwarzen Haaren durch sein Dorf stolzierte. Mit geschwellter Brust und einem langen Stock an die Schulter gelehnt ging er den größten Weg des Dorfes entlang, um bis zu seinem Haus zu gelangen. Nebenbei grüßte er die anderen Dorfbewohner mit einem freundlichen Lächeln und kleinen Verbeugungen.
Als er angekommen war, zog er grinsend die Schiebetür seines Zuhauses auf und rief: „Mami, Papi! Ich bin wieder zu Hause! Können wir endlich mit dem Training beginnen?“
„Papa ist draußen im Hof und wartet schon auf dich, Schatz…“, antwortete ihm eine Frauenstimme.
Als er das gehört hatte, schob er die Tür wieder zu und rannte um das Haus herum, um zum Hof zu gelangen. Das Haus war recht groß. Es war auf relativ kleinen Stelzen gebaut, die das Fundament trugen und wurde noch von einer Holzterrasse umrandet.
„Papi! Da bin ich wieder“, meinte der Junge fröhlich.
„Ah, wie ich sehe, hast du deine Aufgabe erfüllt, Ryoma.“ Der Mann streichelte ihm durchs Haar und grinste dabei. „Du bist ja immer noch nicht größer geworden!“ Er musste lachen.
„Bin ich wohl!“, erwiderte Ryoma. „Ich komm dir jetzt schon an die Brust, Papi.“
„Ich habe eine ganz andere Meinung darüber“, meinte Ryomas Vater und lachte wieder herzhaft. „Lass uns jetzt doch mit dem Training beginnen.“
„Hier, Papi“, sagte Ryoma und übergab ihm seinen Stock.
„Aha… Den hast du dir also ausgesucht?“, fragte sein Vater und untersuchte den Stock genau.
Ryoma nickte nur. Gespannt sah er seinem Vater zu, er konnte es fast nicht mehr erwarten.
Sein Vater beobachtete den Stock weiter. Ryoma konnte es einfach nicht mehr aushalten. Er wollte jetzt unbedingt wissen, ob das wirklich eine gute Wahl gewesen war. Er blickte zu seinem Vater hoch und er zu ihm herunter. Sie starrten sich an und plötzlich fing sein Vater an, laut zu lachen. Ryoma erschreckte erst, tat es seinem Vater dann aber gleich.
„Eine sehr gute Wahl, das muss man dir lassen! Aber du hast keinen Grund, zu lachen! Das Training hat noch nicht mal richtig angefangen.“
„Geht klar, Papi…“
„Also, du hast schon mal die erste Hürde geschafft, jetzt kommt die nächste. Du musst versuchen, mir den Stock abzunehmen! Ich wünsche dir viel Glück.“
Ryoma grinste so, als hätte er schon einen Plan. Sein Vater stand nur da und spielte ein wenig mit dem Stock herum.
Ryoma holte tief Luft und holte mit seinem rechten Bein Schwung, um damit seinen Vater ins Schienbein zu treten, doch der sprang einfach in die Luft und wich somit dem Tritt aus. Ryoma wollte diese Chance nutzen und gleich seinen Vater bei der Landung stören. Er rammte ihn, so dass er ihn hätte treffen müssen. Leider war das nicht der Fall und er stolperte über das Bein seines Vaters.
„Wie hast du das gemacht?“, wunderte Ryoma sich und streifte sich den Dreck von der Kleidung.
„Sauber machen kannst du dich auch, wenn du mit kämpfen fertig bist“, erwiderte sein Vater und schlug ihm mit dem Stock auf den Kopf.
„Autsch! Das tut doch weh!“, rief er und rieb sich seinen Kopf.
Sein Vater musste wieder lachen: „Du lernst es nie, nicht wahr, Ryoma?“
Ryomas Vater war ein muskulöser Mann mit langen schwarze Rastalocken, die er zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Der graue Kimono hatte ein schönes, weißes Bambusmuster darauf. Das kantige und narbige Gesicht wollte Ryoma nie missen. Er kannte seinen Vater nicht ohne diese Narben und schon oft stellte er es sich eigenartig vor, wenn er sie nicht gehabt hätte. Im Allgemeinen war sein Vater für ihn eine sehr wichtige Bezugsperson. Endlich hatte er einmal Urlaub von seinen Reisen genommen und Zeit für ihn und Ryomas Mutter genommen. Jetzt konnte er auch Ryoma im Schwertkampf unterrichten. Darauf hatte sich sein Sohn schon Wochen vor seiner Ankunft gefreut. Endlich war es soweit!
Nachdem Ryoma wieder bereit war, rannte er wieder direkt auf seinen Vater zu. Doch dieser kniete sich hin, legte den Stock auf den Boden und wartete ab. Einen Moment bevor Ryoma ihn rammen konnte, sprang er über Ryoma drüber und legte eine Schraube samt Landung hin. Ryoma prallte schnurstracks an den nächsten Baum und bekam wieder eine Beule.
„So lang du die Fähigkeiten deines Gegners nicht genau kennst“, fing sein Vater an, „brauchst du gar nicht erst versuchen, diesen frontal anzugreifen. Lass dir das eine Lehre sein…“
Er wurde von Ryomas Mutter unterbrochen: „Kommt doch endlich rein, das Essen ist fertig!“
Sein Vater sah Ryoma direkt in die Augen und dieser wusste, was er meinte. Er fing an zu grinsen. Dieses Spiel kannte er von früher, wer als letzter am Essenstisch saß, musste später abspülen. Diesmal konnte Ryoma einfach nicht verlieren! Nicht so wie die letzten Male, nein, heute würde sich das ändern. Da war er sich ganz sicher.
Er nahm Anlauf und sprintete los, sprang auf die Veranda und öffnete die Schiebetür. Sein Vater kam von hinten heran gesprungen und drückte ihn auf die Seite. Siegessicher sah er Ryoma an und streckte ihm die Zunge raus. Ryoma stand auf und rannte einen anderen Weg durchs Haus.
Seine Mutter wartete schon am Essenstisch, als sein Vater dazu stieß. Im selben Moment kam auch Ryoma in das Zimmer.
„Setzt euch doch“, meinte seine Mutter.
Dies taten sie auch, aber mit was für einem Schwung die sich auf den Boden setzten, sodass die Teller gleich mit hüpften.
Zu essen gab es Reis mit Fleisch und Gemüse. Ryoma nahm sich gleich reichlich, ebenso sein Vater.
„Nimm Junge, nimm. Du kannst nicht genug haben.“ Er schob ihm noch eine Schüssel hin und lachte. „Damit du groß und stark wirst, so wie dein alter Herr!“
„Ich bin doch schon groß!“, rief Ryoma und streckte ihm die Zunge raus, dabei viel ihm der halbe Inhalt seines Mundes hinaus.
Alle am Tisch fingen an zu lachen und hörten lange nicht mehr auf damit.
Am Abend erzählte Ryomas Vater spannende, lustige und interessante Geschichten, über seine Reise durchs Land. Tränen schossen seiner Mutter wieder hoch und sie freute sich richtig, ihren Mann wieder zu Hause zu haben. Als Ryomas Vater das bemerkte, schaute er bedrückt zu Boden, rutschte zu seiner Frau und legte ihr den Arm um die Schulter. Er flüsterte ihr irgendetwas ins Ohr, das Ryoma nicht verstehen konnte. Sie sah ihm in die Augen und umarmte ihn fest.
Ryoma verstand in diesem Moment noch nicht, was später passieren sollte.
In den nächsten Tagen konzentrierten sich Ryoma und sein Vater so gut sie konnten auf das Training. Es sah so aus, als ob Ryomas Vater unbedingt wollte, dass Ryoma ein starker Schwertkämpfer wurde.
Verträumt sah Ryomas Mutter den beiden Tag für Tag zu. Sie erzählte Ryoma schon einmal, dass sie seinem Vater früher zu gerne beim Training zugesehen hatte. Das war genau die Zeit, in der sie sich in ihn verliebt hatte.
In diesen Tagen lehrte sein Vater ihm richtige Kampftechniken, verschiedene Tricks und kümmerte sich auch um seine Kondition. Ryoma strengte sich sehr dafür an, gut zu werden, denn sein Wunsch war es, genauso stark wie sein Vater zu werden.
Die Woche verging ziemlich rasch und dieser besondere Tag sollte Ryoma immer in Erinnerung bleiben.
Es schüttete in Strömen. Der Himmel war bedeckt von riesigen, grauen Wolkenmassen, die ihr ganzes Wasser abließen. An diesem Tag trainierte Ryoma allein im Hof. Mit all seiner Mühe versuchte er, diese geniale Technik seines Vaters zu lernen. Verzweifelt machte er jeden einzelnen Schritt, jeden Griff, einfach alles Nötige nach, um diese Technik endlich zu erlernen.
Nach einigen Stunden des Trainings ging sein Vater zu ihm. Mit einem Strohhut auf dem Kopf, vor dem Regen geschützt, trat er ihm entgegen. Voller Stolz schwellte Ryoma seine Brust, strich sich seine nassen Haare aus dem Gesicht und grinste.
„Ich glaube, ich kann es jetzt“, prahlte Ryoma.
„Ryoma…“, murmelte sein Vater. „Es tut mir Leid.“
Er drückte ihn an seinen Körper und wuschelte ihm durch sein nasses Haar. Danach verschwand er.
Ryoma stand allein im Regen. Es donnerte. Der Regen nahm kein Ende.
„Ich habe es geschafft!“, brüllte er. „Geschafft!“
Die Tränen schossen ihm aus den Augen. „Papi…“
Er rannte ins Haus, auf dem direkten Weg ins Wohnzimmer. Verärgert riss er die Tür auf, blickte seine Mutter an, die weinend auf dem Boden saß und sich die Tränen aus dem Gesicht wischte.
„Mami!? Wo ist Papi hingegangen?“, fragte er.
„Komm her, Schatz…“, sagte sie und dies tat er auch. „Papa ist wieder auf Reisen gegangen. Er wird so schnell nicht wieder kommen…“, meinte sie und drückte Ryoma fest an sich.
„Aber…“, schluchzte Ryoma. „Ich kann es endlich! Ich habe es geschafft! Ich… Ich kann Papi jetzt stolz machen!“
Sie sahen sich gegenseitig an. Das wunderschöne Gesicht seiner Mutter lächelte ihn an. Voller Hoffnung glitzerten ihre großen braunen Augen: „Du bist genau wie er…“
In den nächsten Tagen trainierte Ryoma weiter. Er war etwas unsicher, ob er diese Technik wirklich beherrschte und übte weiter. Während der Zeit, in der er nicht mit dem Kämpfen beschäftigt war, träumte er davon auch einmal Abenteuer zu erleben, wie sein Vater. Was er wohl davon halten würde?
Diese Frage wurde nie beantwortet, denn Ryoma sah seinen Vater zu dieser Zeit zum letzten Male.
 Spezialkapitel O – Strömender Regenfluss
Spezialkapitel O – Strömender Regenfluss
„Schau mal da! Da schwimmt ein kleiner Fisch!“, rief ein kleines blondes Mädchen, das an einem Bach stand und die Fische betrachtete. „Komm schon, Großmutter! Schau ihn dir an!“
Schnaufend kam ihre Großmutter her gerannt und stützte sich erstmal auf die Knie vor Erschöpfung.
„Großmutter, da bist du ja endlich!“, begrüßte das 6-jährige Mädchen sie.
„Was hast du denn gefunden, Oto?“, fragte die alte Dame neugierig.
„Da, schau mal, der Fisch! Der glitzert richtig im Sonnenlicht.“
Die beiden standen an diesem sonnigen Tag vor einem kleinen Bach.
„Da! Da ist noch einer!“, erkannte Oto und zerrte eifrig am Ärmel ihrer Großmutter. „Der glitzert ja noch viel schöner! Und da! Noch einer! Boah! Der ist ja riesig!“
Ihre Großmutter fing an zu lachen: „Du lässt dich aber auch gern von allem und jedem begeistern.“
Sie streichelte noch Otos Kopf, dann verschwand sie in das nahe gelegene Haus.
„Och, Großmutter! Bleib doch hier!“ Enttäuscht setzte sich Oto an das Ufer des Baches und ließ ihre nackten Füße ins kalte Wasser hängen.
„Ihr Fischchen bleibt schön bei mir, oder?“
Sie grinste und sah den Fischen weiter beim Schwimmen zu. Einer der Fische schwamm sogar um ihren Fuß herum.
Nach einiger Zeit wurde sie ins Haus gerufen, um zu Mittag zu essen. Sie verabschiedete sich schnell von den kleinen Fischen und dann ging sie ebenfalls ins Haus. Gut gelaunt setzte sie sich an den großen Esstisch, an dem bereits ihre Großmutter saß.
„Fang du doch schon mal mit dem Essen an“, erzählte sie. „Ich geh nur noch kurz nach oben und bringe Mama und Papa ihr Essen, ok?“
Grinsend nickte Oto und schlürfte fleißig an ihrer Suppe weiter, in der auch ein paar kleine Knödel schwammen.
Ihre Beine schwangen hin und her und leise summte sie ein fröhliches Lied, welches ihre kranke Mutter immer vor dem Schlafengehen vorsang.
Als ihre Großmutter wieder herunter kam, um dann endlich auch zu essen, schaute Oto sie neugierig an.
„Wie geht es Mama?“
Als ihre Großmutter diese Frage hörte, bemerkte man den bedrückten Gesichtsausdruck.
„Jetzt sag schon, Großmutter! Wie geht es Mama?“
„Ihr Fieber ist wieder gestiegen. Mama muss wohl bald in ein Krankenhaus verlegt werden…“ Sie setzte den Löffel ab und massierte sich die Schläfen.
„Dann kann ich sie ja jeden Tag in Funtraprolis besuchen kommen! Ich pflück ihr dann auch immer schöne Blumen!“ Sie strahlte ihre Großmutter schon fast an, so sehr grinste sie.
Ihre Großmutter seufzte.
„Oto… Das wird leider nicht möglich sein. Sie wird in ein bestimmtes Dorf gebracht, in dem alle möglichen Ärzte, Doktoren und Experten für Krankheiten leben. Papa wird wohl mit ihr reisen müssen.“
Die Stimmung veränderte sich schlagartig. Oto machte große Augen und begann zu weinen.
„Aber! Papa und Mama dürfen nicht gehen! Nein, niemals! Ich hab sie doch so lieb!“ Sie sprang von dem Stuhl, der dadurch umkippte und rannte aus dem Haus.
„Oto! Warte! Es ist doch für Mama! Damit sie wieder gesund wird!“, rief ihre Großmutter noch hinter her.
Oto verstand die Welt nicht mehr. Bisher war die Krankheit ihrer Mutter doch nicht so schlimm gewesen. Nun gut, sie hatte vor ein paar Monaten Blut gehustet, als Oto versucht hatte, sie zu füttern, aber das hatte wieder aufgehört. Sie war auch oft einfach zusammengebrochen, als sie versucht hatte, mit Oto einen kleinen Spaziergang zu machen. Ihre Mutter sah auch so abgemagert aus.
Aber dies alles störte Oto nicht. Sie kannte keinen anderen Anblick ihrer Mutter. Sie liebte sie über alles und sie hatte einen Traum: Eines Tages eine so gute Medizinerin zu sein, dass sie ihre Mutter wieder gesund machen konnte.
Oto wusste nicht mehr, seit wann sie davon träumte, aber sie wusste, dass sie es eines Tages schaffen würde. Sie musste es einfach schaffen!
Ihre Eltern arbeiteten in dem Krankenhaus in Funtraprolis. Ihre Mutter war bis zum Beginn ihrer Krankheit als Krankenschwester tätig gewesen. Ihr Vater arbeitete als normaler Arzt. Selbst er wusste bei Otos Mutter nicht weiter. Jahrelang hatte er all seine Kraft in sie gesetzt, und versucht, ihr ein so gutes Leben wie möglich zu schenken. Oto sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen, also unterstützte er sie, indem er ihr ein paar medizinische Handgriffe zeigte. Oto entdeckte auch schon heilende Fähigkeiten in ihr, die aber bisher noch nicht so stark waren, etwas richtig zu heilen.
Sie setzte sich wieder an den kleinen Bach und weinte.
„Warum nur, Mama? Kannst du nicht einfach da bleiben?“ Sie schniefte und hörte nicht mehr auf zu weinen.
„Oto…“, sagte eine Stimme. „Sie muss gehen… sonst wird sie nie geheilt…“
Ihre Großmutter setzte sich mit an den Bach und versuchte es ihr zu erklären.
„Aber ich werde eine ganz gute Ärztin! Ich werde Mama heilen!“
„Ach, Oto, das ist so lieb von dir… Aber du brauchst noch einige Jahre, bis du deine Ausbildung überhaupt anfangen kannst. Das ist leider die Wahrheit… Du willst doch Mama nicht noch länger so leiden sehen, oder?“
„Aber ich pflück auch die schönsten Blumen! Ich bastle auch wieder so ein schönes Windspiel, wie ich es letztes Jahr getan habe! Und dann werde ich Ärztin und heile Mama!“
Die weichen Hände ihrer Großmutter berührten ihr Gesicht. Oto sah zu ihrer Großmutter hoch, die schon längst angefangen hatte, zu weinen.
„Oto, du bist so ein herzensguter Mensch…“
Sie drückten sich und hörten gar nicht mehr auf zu weinen.
Der restliche Tag war sehr still. Oto half überall da, wo sie nur konnte. Es schien so, als wären neue Kräfte in ihr erweckt worden.
Energisch drängte sie ihren Vater jede freie Minute dazu, ihr mehr und mehr beizubringen.
Sie erkannte nicht, wie sehr auch ihr Vater unter der Krankheit ihrer Mutter zu leiden hatte. Der große Mann, der immer eine Brille trug, kurzes braunes Haar hatte und sie immer so schön anlächelte, verdrängte seinen wahren Schmerz auch immer vor ihr.
Zusammen übten sie Heilkräuter zu mischen und Oto lernte verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für diese Mixturen. Als sie dann allein etwas experimentieren sollte, steckte sie ihr ganzes Herzblut in die neue Aufgabe. Nach über zwei Stunden rannte sie erschöpft, aber auch stolz zu ihrem Vater und zeigte ihm das Ergebnis.
„Das hast du wirklich fein gemacht, ich bin wirklich stolz auf dich. Du gehst jetzt zu Großmutter runter, lässt dir eine große Schüssel Eis geben und legst dich in dein Bett, in Ordnung?“
Er streichelte ihr wieder den Kopf, dann verschwand sie. Nach weniger als fünf Minuten lag sie schon in ihrem Bett und verspeiste das allzu köstliche Vanilleeis. Ihre Großmutter saß vor ihrem Bett und las ihr noch eine Geschichte vor.
Die nächsten paar Tage vergingen wie im Flug. Oto trainierte wieder oft und half auch überall mit. Sie unterhielt sich noch häufig und lange mit ihrer Mutter und brachte sie sogar ein paar Mal zum Lachen. Oto hatte so viel Freude daran, den ganzen Tag mit ihrer Mutter zu verbringen. Nun ja, sie konnte nichts anderes machen, denn es schüttete wie aus Eimern, weswegen sie nicht rausgehen konnte. Eigentlich war das ja Otos Lieblingswetter. Sie mochte nichts lieber, als stundenlang im Nass rumzutänzeln, doch ihre Großmutter hatte es ihr im Moment verboten, weil sie befürchtete, dass Oto auch krank werden würde.
Bald war der Tag der Abreise ihrer Eltern gekommen.
Oto war die Erste, die Aufstand und das Frühstück vorbereitete. Sie versuchte super leckeres Essen zu kochen, doch sie wusste nicht wie. Also weckte sie ihre Großmutter auf und bat sie, für sie zu kochen.
Verschlafen machte sich ihre Großmutter also daran, ein Frühstück zu kochen. Oto machte derweil alles andere fertig, brachte dann das Essen hoch in das Zimmer ihrer Mutter und ließ sie und ihren Vater gemeinsam und in aller Ruhe frühstücken. Es schien so, als verdrängte sie, dass sie ihre Eltern bald nicht mehr sehen würde, da sie die ganze Zeit grinste.
Die restliche Zeit bis Mittag verging rasch. Es war für ihre Eltern die Zeit gekommen, aufzubrechen. Ihr Vater trug ihre Mutter auf den Karren, den er extra besorgt hatte. Er war schön ausgepolstert mit Decken. Nahrung und Wasser für die Reise und alles Mögliche, was man noch so gebrauchen konnte, war darauf ebenfalls verstaut. Auch an das Wetter hatte er gedacht und den Wagen noch überdacht. An diesem Tag wollte es gar nicht aufhören zu regnen.
Als Abschiedsgeschenk hatte Oto für ihre Eltern zwei Anhänger gemacht. An diesen hing ein schöner hellblauer Stein in Form eines O’s.
Beide drückten Oto noch einmal fest, gaben ihr einen Kuss auf die Wange und flüsterten ihr ins Ohr: „Wir sind bald wieder da, dann wird Mama wieder gesund und wir können jeden Tag zusammen spielen, ok? Das ist ein Versprechen…“
Das waren die letzten Worte, die sie seit dem von ihren Eltern gehört hatte.
Diese Worte konnte sie nie vergessen, sie wollte sie nicht vergessen.
Oto war die nächsten Tage ziemlich ruhig. Anders als sonst. Dass ihre Eltern für einige Zeit nicht mehr da waren, machte sie anfangs wirklich noch sehr traurig.
Nach einigen Monaten, in denen sie nichts tat, entschied sie sich, nach Funtraprolis zu gehen, um dort im Krankenhaus zu lernen. Es sah ziemlich komisch aus, wie jeden Morgen ein kleines 6-jähriges Mädchen in diese große Stadt stolzierte, um im Krankenhaus zu lernen. Glücklicherweise sprach ihre Großmutter mit dem dort zugehörigen Chefarzt, der dann alles klarstellte. Oto lernte so viel sie konnte, denn sie hatte einen Traum: eines Tages in das Med-Dorf zu gehen, nach ihrer Mutter zu schauen und sie zu heilen.
 Spezialkapitel A – Die unendliche Gier des Meeres
Spezialkapitel A – Die unendliche Gier des Meeres
„Ama, wach auf“, sagte eine Frau mit sanfter Stimme und rüttelte leicht an Amas Schulter. „Deine Schwester ist schon wach…“
„Guten Morgen, Mama…“, murmelte er, setzte sich auf und gähnte herzhaft.
„Du weißt ja, was heute für ein Tag ist?“
Er nickte, fuhr sich durch seine zerzausten Haare und lächelte dann ganz benommen.
„Das ist gut. Zuvor sollten wir aber noch frühstücken, findest du nicht auch?“
„Japp, das sollten wir“, antwortete er gut gelaunt.
„Dann zieh dich doch an und komm runter, wir sehen uns gleich…“
Er sah seine Mutter die Treppen hinunter laufen und bemerkte, wie sehr ihre langen schwarzen Haare, die sie wie gewöhnlich zu einem Zopf zusammengebunden hatte, glänzten. Schnell kletterte er sein Stockbett herunter, öffnete eine Schublade einer kleinen Kommode und zog Unterhose, Hose und ein Shirt heraus. Die streifte er sich schnell über und packte noch eine Badehose in seine Tasche. Wie ein geölter Blitz war er nun schnell in das Bad nach unten gerannt, kämmte seine schulterlangen Haare und band sie ebenfalls zu einem Zopf zusammen. Grinsend stolzierte er dann in die Küche und sah dort seine Mutter zusammen mit seiner großen Schwester und seinem Vater an dem Frühstückstisch sitzen.
„Da bist du ja, Ama“, begrüßte ihn seine Schwester. „Wir haben ganz schön lang auf dich gewartet.“
Sie kicherte ein wenig, denn sie wusste, dass ihm das nicht gefiel.
„Ja und?“, fragte er. „Dafür werde ich heute Kapitän sein!“
„Du und Kapitän? Daaa muss ich noch mit deiner Mutter darüber reden“, mischte sich sein Vater ein und grinste ihn frech an.
„Mama, sag doch auch was“, entgegnete Ama in einem fast weinerlichen Ton. Seine Mutter sah vorwurfsvoll in die Runde. „Heute darfst du der Kapitän sein“, erklärte sie und lächelte.
„Juhuuuuu! Danke Mam!“, rief er aus und umarmte sie kräftig.
„Aber zuvor solltest du noch was essen, ok?“
Ama nickte wieder und setzte sich an den Tisch, um mit dem Frühstück zu beginnen. Sein Vater war ein großer, stattlicher und sehr muskulöser Mann. Seine Haut war braungebrannt, wie eigentlich bei jedem in der Familie. Seine Schwester, die vier Jahre älter als Ama war, sah ihrer Mutter sehr ähnlich. Bis auf Amas Vater hatten alle langes, schwarzes Haar. Ama selbst war zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt.
Heute war also der große Tag für Ama. Sie alle planten einen netten Familienausflug hinaus aufs Meer. Dort wollten sie einen Tag verbringen, angeln und schwimmen. Sein Vater kannte da einige schöne Stellen und Riffs. Ama liebte das. Es machte ihm immensen Spaß, dort aufs Meer hinaus zu fahren, ins unbekannte Wasser zu springen, zu schwimmen und nach Schätzen zu tauchen. Meist fand er zwar nur Müll, aber es machte trotzdem Spaß. Aber einmal, da fand er einen ganz schönen Ring. Dieser liegt nun in einem Regalfach in seinem Zimmer, in dem auch einige schöne Muscheln lagen. In einer dreckigen Büchse befanden sich eine Sammlung schöner Steine. Obwohl diese Schätze nicht viel Wert waren, war er trotzdem ziemlich stolz auf seine tollen Funde. Was er genauso liebte war das traditionelle Wettschwimmen mit seiner Schwester, das von seinem Vater ausging. Dieser wollte Jahr für Jahr wissen, wer der – beziehungsweise die – Beste war. Bisher gewann leider immer Ashikaga, seine große Schwester. Dennoch war er sicher, dass er gewinnen würde. Er war siegessicher und sah sich schon gewinnen. Dieses Jahr musste es einfach klappen, denn in den letzten Wochen hatte er ziemlich oft geübt.
Genüsslich aß er von seinen Broten und sah Ashikaga mit diesem ‚Ich-werde-heute-hundert-pro-gewinnen-Blick’ an. Noch herrschte Ruhe und seine Eltern genossen noch die letzten Momente der Stille. Als dann alle fertig mit dem Frühstück waren, deckte seine Mutter den Tisch ab und spülte noch einmal.
„Hört zu, ihr zwei…“, kündigte Amas Vater an. „Ihr habt jetzt noch eine Stunde, um alles Nötige zusammenzupacken. Ich werde in einer Stunde hochkommen und überprüfen, ob ihr nichts vergessen habt, verstanden?“
Beide nickten und rannten schnell hoch in ihr Zimmer.
„Heute wird ein toller Tag“, wandte er sich zu Amas Mutter und gab ihr einen langen Kuss. Mittlerweile waren Ama und Ashikaga oben angekommen. Seine große Schwester legte sich erst in ihr Bett und ruhte sich noch ein Weilchen aus.
„Schwesterchen, warum packst du nicht?“, fragte er neugierig nach während er noch einige weiter Dinge in seine Tasche packte.
„Tja, Ama, ich hab alles schon gestern gepackt. Das Einzige, was mir noch übrigbleibt, ist den Bikini anzuziehen, den du wieder mal vor mir versteckt hast, damit ich nicht schwimmen gehen kann, stimmt’s?“
„Du bist guuut“, brummte er und packte schmollend seine Sachen weiter. „Aber du wirst ihn nie finden.“
Er sah sie an und streckte seine Zunge raus.
„Ich habe ihn heute Morgen, als du noch nicht wach warst, gesucht und gefunden. Es war nicht schwer zu sehen, dass er in deiner Matratze steckte. Deswegen habe ich ihn auch gleich angezogen…“ Sie grinste ihn überfreundlich an und bewies es ihm, indem sie den Kragen ihres Oberteils nach unten zog und somit der Bikini sichtbar wurde. Ama setzte einen wütenden Blick auf und packte stumm ein paar Dinge ein. Ein Netz und ein paar andere Kleinigkeiten. Die Zeit verging ziemlich schnell und Ama stopfte dieses Mal gar nicht so viele Dinge in seinen kleinen Rucksack. Bevor sein Vater zur Visite kam, zog er sich noch schnell aus und schlüpfte in seine Badehose.
„Musst du das hier machen!? Ich sehe deinen… ARGH!“, schrie Ashikaga durchs ganze Zimmer.
„Du musst doch nicht hinschauen…“, sagte er unschuldig und zuckte mit seinen Schultern.
„ARGH!!!“, brüllte sie noch mal und ging ziemlich schnell aus dem Zimmer.
Das ganze Haus, das eigentlich nicht wirklich groß war, bestand nur aus Holz. Es stand am Rande eines Strandes. In dieser Gegend war es ziemlich ruhig. Die einzigen zwei näheren Orte waren zum einen das kleine Dorf Kogeta und zum anderen die große Hafenstadt Vernezye.
„Was hast du denn nun schon wieder angestellt?“, fragte sein Vater, als er das Zimmer betrat.
„Ich habe mich doch nur umgezogen!“, verteidigte sich Ama.
Sein Vater seufzte und setzte sich neben Ama aufs Bett. „Weißt du, deine Schwester kommt langsam in so ein Alter. Da ist sie nun mal etwas empfindlicher, wenn sie unsere Strullermänner sieht. Du solltest da auch in Zukunft vorsichtig sein, ok? Geh doch zum Umziehen einfach ins Bad, geht das klar?“
„Ja, Paps…“
„Und noch etwas…“, fügte er hinzu. „Sei zu anderen Frauen und Mädchen doch auch nicht so.“
„Ich verstehe das Ganze nicht, aber ok, wenn du meinst.“ Er sah ihn wieder grinsend an und zeigte seinen Rucksack vor.
„Ah, na gut, dann lass mich mal sehen“, meinte sein Vater und kramte in der Tasche rum. „Das hast du gut gemacht. Jetzt nimm deine Sachen und komm mit nach unten, ok?“
Fröhlich gestimmt ging er mit seinem Vater nach unten und verließ das Haus. Sie gingen gleich auf ein kleines Holzboot zu, in dem schon seine Mutter und seine Schwester saßen, die ihn wieder so giftig ansah. Sein Vater ruderte das Boot zu einem kleinen Schiff, auf dem sie den Tag verbringen sollten. Dieses kleine Segelschiff fand Ama faszinierend. Er empfand es als ein großes Abenteuer, jedes Mal damit in See zu stechen.
Amas Vater erzählte ihm oft, dass er dieses Schiff einmal von seinem Vater geerbt hätte und wenn Ama groß wäre, er das ebenfalls erben würde. Darauf freute er sich schon riesig. Seine Mutter und seine Schwester brachten die Verpflegung aufs Unterdeck in die Küche. Ama warf seinen Rucksack in den kleinen Steuerraum und half seinem Vater dabei, die Segel vorzubereiten. Als er jedoch nicht helfen konnte, versuchte er, den Anker von Hand aus dem Wasser zu ziehen, was ihm aber nicht gelang. Lachend kam sein Vater und zog den Anker mit Hilfe eines Drehmechanismus aus dem Wasser.
Die Reise konnte beginnen. Der Anker war gelichtet, die Segel gesetzt und nichts konnte die Familie noch aufhalten, einen wunderschönen Tag auf dem Meer zu verbringen. Es dauerte etwas mehr als eine Stunde, bis sie endlich wieder den Anker setzten. Es war eine schöne Fahrt gewesen und Ama roch schon die ganze Zeit diesen tollen Meeresduft. Das Schiff befand sich nun in der Nähe eines Korallenriffs. Ama war schon so aufgeregt, dass er gleich ins Wasser springen wollte. Natürlich fragte er erst nach der Erlaubnis seines Vaters. Dieser nickte nur und sah zu, wie der fröhliche kleine Junge ins Wasser sprang. Das Salzwasser fühlte sich so schön an. Schnell schwamm Ama ein paar Runden um das Schiff, um sich aufzuwärmen.
„Komm doch, Ashikaga, das Wasser ist toll!“, rief er nach oben.
Als jedoch keine Antwort kam, wollte Ama schon wieder aufs Schiff klettern um nachzusehen, aber das konnte er auch vergessen. Denn in diesem Moment sprang seine Schwester in die Luft und landete wie eine Bombe im Wasser. Eine große Wasserfontäne schoss in die Luft und Ama bekam viel Wasser ins Gesicht.
„Hey! Das ist fies!“, brüllte er.
„Du hältst dich doch für einen besseren Schwimmer, stimmt’s? Beweise es mir! Wer schneller an dem Felsen dort ist!“, forderte sie ihn heraus und schwamm los. Ama folgte ihr natürlich sofort. Er schwamm so schnell er konnte aber dennoch holte er seine Schwester nicht ein. Aber nein, er wollte nicht aufgeben. Deswegen nahm er sich alle Kraft zusammen und schwamm schneller denn je. Das Finale war knapp. Ama holte Ashikaga fast ein, die letzten Meter bis zum Felsen waren fast zu Ende.
„GEWONNEN!“, schrie Ashikaga, die als Erste den Felsen berührte.
„Das ist unfair, du hattest Vorsprung“, erwiderte Ama und schwamm langsam zurück.
„Du schlägst mich nie, Ama!“
Stolz schwamm sie zum Boot zurück, wo ihr Vater sie gleich wie der Sieger des Tages beglückwünschte. Danach kam er zu Ama, der sich gerade abtrocknete, und tätschelte ihm auf den Kopf.
„Du bist heute Kapitän“, flüsterte er. „Außerdem schaffst du es nächstes Jahr, da bin ich mir sicher.“
Ama seufzte nur und setzte sich an den von seiner Mutter vorbereiteten Tisch. „Ich hoffe, ihr habt Hunger!“, meinte seine Mutter und stellte ein großes Festmahl auf den Tisch. Es gab Nudeln, Reis, Fisch und noch viele weitere Kleinigkeiten. Ama machte große Augen und nahm sich erstmal von dem Reis. Er tunkte ihn in viele verschiedene Soßen und genoss das Essen richtig. Danach nahm er sich etwas von den gebratenen Nudeln und dem Fisch, den sein Vater vorhin gefangen hatte. Es schmeckte köstlich.
„Wie ihr wisst“, fing seine Mutter an, „gibt es nach dem Essen erst mal wieder eine Pause, bis ihr ins Wasser könnt. Was wollt ihr spielen?“
„Ich wäre für ein Kartenspiel“, antwortete Ashikaga.
„Das ist eine gute Idee“, entgegnete der Vater.
„Sie weiß ganz genau, dass ich da auch immer verliere!“, brüllte Ama, stand vom Tisch auf und verschwand ins Unterdeck.
„Was hat er heute nur?“, seufzte seine Mutter.
„Nur, weil er noch nie gegen mich gewonnen hat“, protze Ashikaga.
„Du solltest nicht immer so fies zu Ama sein“, tadelte ihre Mutter sie.
„Lass ihn wenigstens einmal gewinnen, ok?“, bat ihr Vater.
„Geht klar…“
In der Zwischenzeit legte sich Ama in eine der Hängematten. Natürlich zog er sich zuvor die nasse Badehose aus. Er schlief ziemlich schnell ein. In seinem Traum machte er wieder ein Wettschwimmen mit seiner großen Schwester. Dieses Mal gewann er. Sein Vater und seine Mutter feierten ihn wie einen Helden.
„Ama!“, riefen sie.
Ama schreckte hoch und fiel aus der Hängematte.
„Ama!“, rief ihn seine Mutter.
Blitzschnell schlüpfte er wieder in seine mittlerweile schon trockene Badehose und stürmte nach oben.
„Was ist?“, erkundigte er sich.
„Die Zeit ist vorbei, du kannst wieder ins Wasser…“
„Diesmal geh ich tauchen!“
Ama kramte seine Taucherbrille samt Schnorchel aus seinem Rucksack und sprang mit einem Hechtsprung ins Wasser. Diese Unterwasserwelt, die sich vor ihm öffnete, war ein wunderschönes Gebilde aus Korallen, Seeschnecken und vielen verschiedenen, bunten Fischen. Er glitt durch das Wasser, kam an den farbigsten Korallen vorbei und begrüßte einige Fische mit einem Winken. Ama liebte es, die Unterwasserwelt zu erkunden und am Meeresboden nach Schätzen zu suchen. Glücklicherweise war das Wasser nicht allzu tief. So konnte Ama immer mal wieder hoch zum Luftschnappen kommen. Für seine Größe und sein Alter konnte er relativ lange die Luft anhalten. Das war ein großer Vorteil für ihn. Mit dem Netz, das er bei sich hatte, gründelte er den Meeresboden ab und suchte vergeblich nach Schätzen. Immer mal wieder musste er auftauchen, um nach Luft zu schnappen.
Es verging einige Zeit, bis er aufgab und nach schönen Muscheln suchte. Die Lebenden ließ er natürlich zurück. Er suchte nur nach den verlassenen Muschelschalen, die auch noch schön aussehen sollten. Eine davon, so nahm er sich vor, wollte er unbedingt seiner Mutter schenken. Nach einer langen Zeit fand er endlich ein schön aussehendes, großes Exemplar einer verlassenen Muschel. Voller Freude tauchte er auf, um es seiner Mutter zu schenken. Doch was er über der Wasseroberfläche erblickte, war schrecklich für ihn.
Große Wellen schlugen plötzlich dem Schiff entgegen und seine Eltern und seine Schwester versuchten hektisch alles abfahrbereit zu machen. Sein Vater bereitete schnell das Segel aus, seine Mutter packte alles was nicht niet- und nagelfest war ins Unterdeck.
„Komm, Ama! Wir müssen los!“, schrie seine Schwester und rannte schnell ins Unterdeck. Ama versuchte die kleine Leiter hoch zu klettern, doch immer wieder schlugen Wellen dagegen und er fiel immer wieder ins Wasser zurück. Fast panisch schrie er um Hilfe, bis endlich sein Vater kam und ihn aus dem Wasser holte.
„Keiner gab eine Sturmwarnung für heute heraus!“, beschwerte sich sein Vater bei seiner Mutter.
„Hör auf, dich aufzuregen, wir sollten so schnell es geht zurück zur Küste. Hol den Anker ein, Schatz!“, antwortete sie.
„Mama, Papa! Lasst mich helfen!“, bat Ama.
Es fing an zu regnen. Die Wellen wurden immer heftiger und das Schiff schwankte ziemlich stark. Der Wind blies direkt ins Segel und das Schiff bewegte sich, obwohl der Anker noch auf Grund war.
„Geh zu deiner Schwester!“, brüllte sein Vater ihn an.
„Aber…“, flüsterte er, brüllte dann doch. „Ich hasse sie!“
„Das ist mir egal! Ab ins Unterdeck!“
Seine Mutter versuchte ihn mit ins Unterdeck zu zerren, doch er hielt Widerstand.
„Ich werde helfen! Ich bin heute der Kapitän! Das hast du mir versprochen, Paps!“
„Es ist jetzt keine Zeit zu streiten, wir müssen so schnell wie es geht losfahren!“, rief er, während er den Anker einholte. Es wurde immer unangenehmer. Der starke Wind machte den Regen noch viel schlimmer, als er sowieso schon war. Die tosenden Wellen schlugen immer wieder gegen die Seite des Schiffes und brachten es immer heftiger zu Schwanken. Ama hielt sich mit aller Kraft an dem Mast fest. Tränen liefen über sein Gesicht, als er merkte, dass er wirklich nicht in der Lage war zu helfen. Seine Wahrnehmung wurde langsam immer schlechter. Es wurde unscharf vor seinen Augen. Er hörte nur noch das Donnergrollen und die Wellen, die einfach nicht damit aufhörten, gegen das Schiff zu schlagen.
„Papaaaaa!!!“, schrie er, bevor er von einer monströsen Welle erwischt wurde und wieder im Wasser landete. Sein Vater versuchte ihm noch einen Rettungsring hinterher zu werfen, doch dieser verfehlte sein Ziel.
„AMAAAAAA!!!“, rief sein Vater ihm hinterher, doch Ama bekam nichts mehr mit. Manche Wellen drückten ihn mehrmals unter Wasser und er versuchte immer wieder an die Oberfläche zurückzukehren. Sein Vater versuchte noch, ihm hinterher zu schwimmen, doch das Schiff wurde von einer zweiten riesigen Welle mitgenommen und zerschellte an einem großen Felsengebilde, das in der Nähe war. Es dauerte nicht lange, dass Ama ein Brett auf dem Wasser fand, an dem er sich festhielt. Mit einem tränenüberströmten Gesicht versuchte er gegen die Wellen anzukommen und wieder zurück zu seiner Familie zu schwimmen.
Doch vergebens. Er schaffte es einfach nicht und verlor dazu auch noch all seine Kraft. Langsam wurde er bewusstlos und trieb auf dem Brett liegend über das Meer zurück zur Küste. Am nächsten Morgen wachte Ama auf. Neben ihm lagen ein paar Teile des Schiffes, wie der Mast und die Muschel, die er für seine Mutter gesucht hatte. Er stand auf und sah sich erst benommen um. Als er sich langsam wieder erinnerte, was geschah, rannte er am Strand entlang um seine Eltern zu suchen. Er suchte und suchte und konnte gar nicht mehr aufhören. Seine schwachen Beine trugen ihn bald nicht mehr und er klappte zusammen. Mit letzter Kraft konnte er sich noch aufsetzen. Er ballte seine Fäuste und schlug sie mehrmals in den Sand.
Seine Familie war nicht mehr da. Das Meer hatte sie verschluckt. Tränen liefen wieder über sein Gesicht. Dann schrie er wiederholt: „Gib mir meine Familie wieder zurück!!“
Er war nun allein. Das Einzige was ihm blieb, war das durch den Sturm des letzten Tages in Trümmern zerlegte Haus, diese Muschel und die Erinnerungen an seine Eltern.
In den folgenden Jahren, in denen er täglich aufs Meer hinausfuhr und nach seinen Eltern suchte, war alles unnütz. Er fand sie einfach nicht. Ab und zu entdeckte er auf dem Meeresboden ein paar Bretter des Schiffes seiner Eltern oder einige Gegenstände, die ihm bekannt vorkamen, mehr aber auch nicht.
 Spezialkapitel S – Die Finsternis in deinem Herzen
Spezialkapitel S – Die Finsternis in deinem Herzen
Es war wieder einmal eine der ganz normalen Tage in Sayokos Leben. Sie saß in dem Blumengarten ihrer Eltern und sah ein paar Hasen zu, wie sie durch die Gegend hoppelten. In einer riesigen Blumenwiese liegend beobachtete sie die Wolken und genoss an diesem herrlichen Tag die Sonne. Es war aber auch einer der Tage, an denen sich ihre Eltern wieder stritten.
„Warum streiten Mama und Papa schon wieder!?“, fragte Sayoko genervt.
„Das würden Sie nicht verstehen, Sayoko“, antwortete der Butler.
„Aber Dayu! Sag den beiden, sie sollen aufhören!“, quietschte sie.
„Ich würde das gerne, aber Ihre Eltern würden nicht auf mich hören…“
„Wenn das so weiter geht, hab ich die zwei nicht mehr lieb!“, beschwerte sie sich und ging wieder zurück zu ihrem Lieblingsort, einem kleinen Hügel, auf dem alle möglichen Blumen wuchsen.In diesem Moment kam eine Frau aus der großen Villa, mit langen, roten Haaren und einem Lächeln, wie in einem Märchen.
„Mama, da bist du ja!“, rief Sayoko erfreut, während sie auf ihre Mutter zu rannte.
Sie sprang und ihre Mutter fing sie auf und drehte sich einmal. „Warum haben du und Papa wieder gestritten?“, fragte sie.
„Das würdest du noch nicht verstehen, Sayoko-Schatz…“
„Warum sagt ihr immer, dass ich das nicht verstehe! Ich bin schon 8 Jahre alt! Ich kann sowas schon verstehen“, quengelte sie.
Ihre Mutter umarmte sie. Dabei richtete sie Sayokos langen Zopf und flüsterte: „Ich hab dich ganz doll lieb“
„Ich dich auch Mama!“
„Dayu, ich bitte Sie, ein heißes Bad für mein einzulassen“, bat sie in einem freundlichen Ton.
„Natürlich mach ich das für sie Madame.“
„Vielen Dank, Dayu, Sie sind wie immer ein Schatz“, sagte sie, während sie wieder lächelte, „Also Sayoko, spiel schön weiter, ich nehme nur schnell ein Bad, in Ordnung?“
„Geht klar, Mama!“
Es war ein Tag wie jeder andere für Sayoko. Die Streitereien zwischen ihren Eltern wurden in den letzten Wochen immer häufiger. Anfangs versteckte Sayoko sich noch in ihrem Zimmer, doch mit der Zeit gewöhnte sie ein wenig an die lauten Worte, die ihre Eltern wechselten. Trotzdem fand sie es immer schrecklich, wenn ein neuer Streit ausbrach. Um was sie sich stritten, bemerkte Sayoko nie, Dayu der Butler nahm Sayoko immer mit in den Blumengarten und versuchte sie so gut es ging abzulenken. Sayoko hatte es wirklich nicht leicht, obwohl sie in einer riesigen Villa, in einer reichen Familie, in einer ebenfalls reichen Stadt lebte und es ihr an nichts fehlte. Doch die einzige Person, die sich wirklich um sie kümmerte, war nur noch Dayu, der auch nur für sie sorgte, weil ihre Eltern die ganze Zeit stritten.
Sie war wirklich sehr einsam. Auch wenn sie ihre Schulfreunde besuchte, oder diese sie, dann wirkte sie nicht wirklich anwesend. Es war so, als wäre sie eine einsame Seele, die immer noch nach einem wirklichen Freund suchte. Langsam wurde es Nacht. Dayu brachte Sayoko rein und legte sie schlafen. Sie sollte sich für den kommenden Tag ausruhen, denn auf einer Veranstaltung, die ihr Vater schon vor Wochen plante, sollte sie natürlich fit sein. Sie kuschelte sich in ein riesiges Bett, in dem sich viele Kuscheltiere in allen möglichen Formen befanden. Eine kleiner Aerofant – ein Elefant mit Flügeln -, viele Löwen, Hunde, Pferde, Robben und was sie am liebsten hatte: Hasen. Sie kuschelte sich so gern an einen schon sehr alten und zerfledderten Hasen, den sie seit ihrer Geburt hatte. Ihre Mutter gab ihr diesen Hasen und er bedeutete Sayoko auch ziemlich viel. Langsam schlief sie ein.
Aber auch in dieser unruhigen Nacht, wachte sie nach einem schrecklichen Albtraum auf. Seit dem Beginn der Streitereien zwischen ihren Eltern träumte sie Nacht für Nacht den selben Traum. Sie spazierte in der Villa umher und suchte nach ihrem Kuschelhasen. Plötzlich standen an einem sehr schlechte beleuchteten Ende des Ganges ihre Eltern, eher gesagt, ihr Vater und hatte den Hasen bei sich. In der einen Hand den abgerissenen Kopf und in der anderen den Körper aus dem die Watte herausquoll. Blut tropfte von dem abgetrennten Haupt des Hasen herab.
„Hier Sayoko, dein Hase!“, sagte ihr Vater mit verzerrter Stimme und lachte höhnisch. Dann warf er ihr die zwei Stücke ihres Lieblingshasen entgegen und beide wurden lebendig. Der Hasenkopf bekam messerscharfe Fangzähne und versuchte sie zu beißen, die Krallen des Körpers dürsteten es nach ihrem Blut. Sayoko rannte und rannte, sie fand niemanden der sie hätte beschützen können. Sie weinte und schrie um Hilfe, doch niemand hörte das Echo ihres Hilferufes. Dann wachte sie auf.
Wie gewöhnlich schlich sich Sayoko auch in dieser Nacht in das Schlafzimmer ihrer Mutter. Ja, ihrer Mutter. Sie und ihr Vater schliefen schon seit längerem in getrennten Schlafzimmern.
„Mama“, bat sie, „kann ich heute Nacht wieder bei dir Schlafen?“
Tränen liefen ihr Gesicht herab und sie schluchzte.
„Schon wieder dieser böse Traum?“, fragte ihre Mutter im Halbschlaf, „Nagut, steig rein.“
Sie hob die Decke und Sayoko kuschelte sich eng an den Körper ihrer Mutter. „Danke, Mama… Mama? MAMA? Wo bist du!?“
Plötzlich fühlte sie den Körper ihrer Mutter nicht mehr. Sie schreckte hoch und setzte sich auf. Als sie realisierte, dass sie immer noch in ihrem Bett lag, fing sie an zu weinen. „Mama“, flüsterte sie, „Bist du da?“
Langsam stand sie auf, ihren Hasen fest an sich pressend. Vorsichtig öffnete sie die Tür zum Schlafzimmer ihrer Mutter und fragte in der Dunkelheit, ob sie wieder bei ihr schlafen durfte. Es kam und kam aber keine Antwort und sie hatte umso mehr Angst. Nach dem sie ein wenig nachdachte, bemerkte sie, dass sie ihre Mutter seitdem sie in das Bad gegangen war, nicht mehr gesehen hatte. Lag sie immer noch in der Badewanne? Zitternd schlenderte sie in ihrem langen Nachtgewand zum Bad, das nicht weit entfernt von dem Schlafzimmer war. Sie sah durch das Schlüsselloch Licht brennen, also klopfte sie höflich, wie ihr es ja beigebracht wurde. Quietschend ging die Tür auf. Stille.
Nicht mal das Wasser plätscherte mehr. Das Licht der schon fast zuende gebrannten Kerzen flackerte umher.
Es bewegte sich für Sayoko alles wie in Zeitlupe. Erschrocken ließ sie ihren Hasen fallen, der in einer großen Blutlache landete. Sie wollte schreien, doch sie konnte es nicht. Ihre Augen weiteten sich und die Tränen schossen aus ihr heraus. Was sie dort erblickte, sollte sie ihr ganzes Leben verfolgen. Es befand sich rotes Wasser, was sich langsam als Blut erkennbar machte, in der Wanne, in dem ihre Mutter lag. Anscheinend hatte sie sich die Pulsader aufgeschnitten, oder es zumindest versucht. Mit einer angsterfüllten Stimme flüsterte sie noch: „M…M…Mutter….“
Dann rannte sie so schnell sie konnte zu ihrem Vater. Sie riss die Tür auf und versuchte zu brüllen, doch wieder blieb ihr die Stimme weg, als sie erkannte, dass sich ihr Vater gerade von Blutflecken reinigte. Sie hielt es nicht mehr aus und verließ die Villa. Sayoko wollte einfach nur Weg von Zuhause, so weit es ging!
Weinend stürzte sie aus der Villa, stolperte die Straße entlang und flüchtete vor dem Anblick ihrer toten Mutter und vor dem Bewusstsein, dass ihr Vater der Mörder war. Was tat er da? Wieso musste er sie denn umbringen? Wieso konnte er sie nicht einfach leben lassen? Wieso das alles… wieso….?
In den kommenden Stunden schaffte sie es, aus dieser Stadt zu entfliehen und einen Weg einzugehen, der ihr Leben komplett änderte. Sie war nun nicht mehr die Tochter einer reichen Familie, nein, sie wurde zu einem Straßenkind, das nun jeden Tag aufs Neue um ihr Leben kämpfen musste.
So vergingen die Tage, die Wochen, die Monate, selbst einige Jahre vergingen, in denen Sayoko lernte, wie man als Straßenkind überlebte. Sie erlernte Tricks, wie man leicht überlebt und brachte es jüngeren Straßenkindern bei, die selbst noch nicht so viel Erfahrung hatten. Von Stadt zu Stadt wandernd machte sie sich immer mehr „Freunde“ die sich um sie versammelten. Sie bildete sozusagen kleine Straßengangs, die ihre Hilfe immer mehr beanspruchten.
Eines Tages, kurz nachdem sie ihren 16. Geburtstag „feierte“, befand sich Sayoko in einer kleinen verwahrlosten Stadt. Sie wollte einfach mal etwas Neues ausprobieren und die Städte, in denen sie sonst war, wurden langsam langweilig. Es war das Gefühl nach einem neuen Abenteuer, das sie hier her lockte. Gut gelaunt schritt sie durch diese kleine Stadt, in denen sich viele leerstehende Häuser befanden und suchte nach einer Gelegenheit etwas zu Essen zu bekommen. Bei ihr sah das so aus: Sie klopfte an der Haustür eines wildfremden Menschen. Zuvor drückte sie noch ein paar gekünstelte Tränen aus ihrem Augen und versuchte ein wenig weinerlich zu wirken. Sie klopfte also und meistens fragte diese Person, was sie denn wolle. Genau auf diese Frage antwortete sie immer: „Entschuldigung, aber könnte ich von ihnen ein wenig Brot haben? Meine Mutter liegt krank im Bett, meine sieben kleinen Geschwiser nörgeln die ganze Zeit und ich komme nicht zum Geldverdienen, weil ich ständig auf die Kleinen aufpassen muss. Wir haben kein Geld mehr und außerdem…“, sie künstelte ein paar Tränen, „Mein jüngster Bruder hat heute Geburtstag und ich hatte ihm schon lange einen richtigen Kuchen versprochen, aber…. aber…“
Sie lies sich auf die Knie fallen und tat so, als würde sie weinen. Spätestens an diesem Punkt brachten ihr die Besitzer des Hauses etwas zu Essen und sogar manchmal ein kleines Kuchenstück, das vom Nachmittagskaffee noch übrig blieb.
Auch dieses Mal klappte es, wie sie es wollte. Ein junges Mädchen in ihrem Alter öffnete ihr die Tür und gab ihr etwas zu Essen. Aber das war noch nicht alles, das blondhaarige Mädchen bat sie herein und sie gab ihr nicht nur etwas zu Essen, nein auch Trinken und ein wenig Geld wurde ihr gegeben.
„Das tut mir wirklich Leid, mit deinen Geschwistern und deiner Mutter“, erklärte sie. Sayoko war wirklich überrascht. Noch nie wurde sie so warmherzig behandelt. Sonst schlug man ihr immer die Tür vor der Nase zu, nachdem sie etwas bekam, aber dieses Mal war es wirklich anders.
„Mein Name ist Aishi, ich wohne hier seit ein paar Wochen. Meine Vater ist erst verstorben und meine Mutter habe ich schon bei meiner Geburt verloren. Tja, jetzt wohne ich eben hier in diesem kleinen Haus und versuche, alles so schön wie möglich einzurichten.“
Das sah man nicht wirklich. Fast überall war es noch verstaubt und in einer Ecke des Wohnzimmers stapelten sich ein Haufen alter Möbelstücke. Eine Wand war halb zerfallen, die die Küche vom Wohnzimmer trennte. Aishi schürte Feuer in einem sehr altmodischen Ofen und setzte Tee auf.
„Ich weiß leider nicht, wie schwer es ist, sich um 7 Geschwister und um eine kranke Mutter zu kümmern, aber ich kann es verstehen, dass es sicherlich nicht leicht für dich ist“, sagte sie mit einem netten, aber ehrlichem Lächeln. Sayoko wurde immer nervöser. Was machte sie da? Ihr wurde ziemlich viel zu Essen gegeben, von einem Mädchen, dass es anscheinend nötiger hatte. Kurzerhand stand Sayoko auf und ging Aishi entgegen. Sie packte ihre Hand und drückte ihr das Essen gegen die Brust.
„Hier nimm! Du hast es wirklich viel nötiger als ich! Dass ich Geschwister und eine kranke Mutter habe, war alles nur gelogen! Ich… ich… ich lebe allein auf der Straße und klaue sozusagen Nahrung von Anderen! Bitte, nimm das Essen wieder!“
Ein paar Tränen liefen ihr Gesicht hinab. Sayoko war zu gerührt, wie sehr Aishi noch lächeln konnte, obwohl es ihr so schlecht ging.
Sayoko schwor sich von Anfang an, nichts von Leuten anzunehmen, die es nötiger hatten als sie, oder von anderen Straßenkindern zu klauen, das war wirklich nicht ihre Art. Deswegen musste sie das Essen nun zurückgeben.
„Ehm, entschuldigen Sie, aber…“
„Nichts aber! Und sieze mich bitte nicht, mein Name ist Sayoko!“, stellte sie sich vor und wollte gerade das Haus verlassen, als das blondhaarige Mädchen sie aufhielt.
„Du sagtest, du lebst auf der Straße, Sayoko…“
Sie nickte aufmerksam und zögerte, hinauszugehen. „Bleib doch ein bisschen bei mir! Ich wohne doch sowieso alleine, also… leiste mir ein wenig Gesellschaft.“
Das Mädchen strahlte auf irgendeine Art und Weise eine Nettigkeit aus, die Sayoko in ihren Bann zog.
„Nagut, dann bleib ich hier. Habe keine Besitztümer, die ich packen könnte, also kann ich doch gleich hierbleiben, oder?“, antwortete Sayoko aus einem Reflex heraus, den sie vorerst nicht verstand. Doch Aishis Lächeln zog sie so sehr an.
„Ja, natürlich!“, freute sich Aishi, die den Tee servierte.
So geschah es, dass sich Sayoko und Aishi sich anfreundeten. Sie wurden sogar so dicke Freunde, dass Sayoko ihr Überlebenstricks zeigte, ihr half, das Haus zu renovieren und jeden Tag miteinander verbrachten. Sayoko fühlte sich grandios. Endlich hatte sie die Art von Freundin gesucht, die sie schon jahrelang suchte. Sie konnten sich so viel erzählen, von lustigen, aber auch traurigen Situationen, wie den Tod von Sayokos Mutter. Ständig fanden sie neue Dinge, über die sie gemeinsam Lachen und auch Trauern konnten. Es ging sogar so weit, dass Sayoko sich verliebte. Sie war so erfüllt von dem Zusammensein mit Aishi, dass sie sich in ihre blondhaarige Freundin verliebte. Eines Tages, als sie neben sich im Bett lagen, begann Sayoko sich zu bedanken.
„Aishi… Ich danke dir für alles, was du mir in diesem letzten Jahr alles geschenkt hast. Du hast es vielleicht vergessen, aber heute, genau vor einem Jahr sind wir Freundinnen geworden. Es war so toll, das alles mit dir erleben zu dürfen…“
„Sayoko…“
„Was ist?“
„Du redest so, als würde das alles in Zukunft nicht mehr passieren, das… das macht mich traurig…“, entgegnete Aishi leise.
„Es… es tut mir leid! Das… das war wirklich nicht meine Absicht…!“
„Wenn du es jetzt nicht mehr so meinst, ist es ja in Ordnung“, flüsterte Aishi und kuschelte sich an Sayokos Seite.
Ein tolles Gefühl schoss durch ihren Körper und sie streichelte Aishis Rücken. Es fühlte sich so großartig an, sie bei sich zu haben. Einerseits konnte sie Aishi beschützen und andererseits, konnte Sayoko sein wer sie wollte. Sie konnte ihre Fassade runterlassen und frei sein. Frei leben und frei fühlen. Sie sah Aishi zu. Ihr hübsches Gesicht und ihre schönen Lippen. Dann atmete Sayoko einmal tief ein und wieder aus. Vorsichtig bewegte sie ihren Kopf nach vorn und versuchte Aishi zu küssen. Sanft setzte sie ihre Lippen auf Aishis. Doch der Kuss wurde nicht erwidert, Aishi war eingeschlafen und Sayoko beruhigt. Ihr wäre es im Nachhinein doch peinlich gewesen. Nach einiger Zeit, die Sayoko damit verbrachte über Aishi nachzudenken, schlief sie ebenfalls ein.
Nach einer Woche, passierte etwas Schreckliches. Aishi wurde krank und selbst nach ein paar Tagen intensiver Pflege Sayokos wurde es mit ihr einfach nicht besser. Sie lag nur noch hustend im Bett und rührte sich keinen Millimeter. Ihre blasse Haut schien im Sonnenlicht noch mehr zu verblassen und auch die Schmerzen, die sie erlitt, wurden nicht besser. Nicht nur sie litt unter der Krankheit, Sayoko tat es ebenfalls. Sie verzweifelte schon daran, weil es einfach nicht besser gehen wollte.
Sie versuchte auch schon einen Arzt zu finden, der sie hätte heilen können, aber vergebens. Der einzige Arzt, der ihnen hätte helfen können, würde eine große Geldsumme verlangen und außerdem war er noch nicht mal in der Stadt. Was war das für eine grausame Welt? Selbst die Nachbarn oder andere Stadtbewohner konnten ihr nicht helfen. So litt Aishi weiter und starkem Fieber, ständigen Husten und Schmerzen im ganzen Körper.Nacht für Nacht verbrachte Sayoko neben dem Bett sitzend und hoffend, dass es ihr bald besser ginge. Langsam nagten an ihr die Folgen der langen Nächte und des Hungers. All das Geld, dass sie hatten, gab sie für Medikamente und Nahrung allein für Aishi aus. Aber… es nützte nichts. Zerbrechlich und kaputt saß sie eines Nachts wieder neben Aishi, die nicht mehr aufhörte zu Husten. Langsam senkte sich der Andrang der Hustanfälle und es wurde ruhiger.
„Sayoko“, murmelte Aishi, die immer schwächer wurde, „Danke, danke für alles, dass du mir gegeben hast… Du warst und bist immer noch meine beste Freundin, die ich jemals hatte…“
„Sag doch nicht sowas!“, rief sie aufgebracht, „Du sagst das so, als wäre es vorbei!“
„Es… es ist noch nicht vorbei, ich weiß es…“
„Sei stark! Ich weiß dass du es schaffen wirst… es dauert nicht mehr lange, dann… dann bist du wieder gesund!!“
„Danke Sayoko.. du…“, ihre Stimme wurde immer leiser, „du hast es schon so weit geschafft, dann schaffst du es auch weiterhin….“
„Was redest du da!? DU schaffst es, du musst es schaffen! Du lässt dich doch nicht einfach so einer mickrigen Krankheit besiegen! Jetzt sei nicht so!“
Sayoko begann wieder zu weinen. Sie schlug die Arme vor das Gesicht, kniete vor das Bett und stützte sich darauf.
„Du… du kannst jetzt nicht aufgeben!“
Sie hörte nicht auf zu weinen. Die zarten Finger Aishis streichelten ihr durchs Haar.
„Weißt du noch, damals, als du mir das erste mal gezeigt hast, wie man sich Äpfel klaut? Das war lustig. Oder als wir uns über diesen einen Glatzkopf lustig gemacht haben… Wir… Wir hatten echt eine schöne Zeit…“
„Das werden wir doch wieder haben! Aishi!“
„Sayoko… Das Schicksal hält für uns Aufgaben bereit, die wir nun einmal lösen müssen… und… wenn… wir diese gelöst haben, dann kommt für jeden der Moment… in …. dem… er… Auf Wiedersehen… sagt……….“
„AISHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!“
Sayoko stütze sich über Aishi. Ihre Tränen hörten nicht auf zu fließen.
„AISHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!“, brüllte sie durchs ganz Haus, „Ich.. ich liebe dich! Gib nicht auf, verdammt! Du schaffst das! AISHIIIIIIIIIIII! Gib bitte nicht auf.. ich.. ich weißt dass du es schaffst.. Aishi, jetzt… bitte….“
Aishi bewegte sich nicht mehr. Weinend küsste Sayoko sie noch ein letztes Mal, dann rannte sie aus dem Haus und rannte einfach fort, fort von dem, was an diesem Ort geschehen war. An einer ruhigen Lichtung angekommen, lies Sayoko sich fallen.
„Warum nur!? Warum muss man mir alles nehmen, was ich liebe!? Erst meine Mutter, und jetzt noch Aishi! Ich liebe sie so sehr… warum.. warum musste man mir alles nehmen!? Verdammt!“
Sie kauerte sich auf den kalten Boden zusammen und hörte nicht mehr auf zu schluchzen und zu weinen. „Warum… musste man mir alles nehmen??“, flüsterte sie leise, bevor sie vor Erschöpfung sanft einschlief.
 Spezialkapitel J – Die Geister, die er rief
Spezialkapitel J – Die Geister, die er rief
Leise kroch ein kleiner Junge mit orangenem Haar aus seinem Bett und schlüpfte in einen Pullover. Er versuchte so leise wie es nur ging aus seinem Zimmer zu schleichen und nach draußen zu kommen. Sanft rieselte der stille Schnee auf die Erde hinab. Im Schein des Mondes glitzerte jede einzelne Schneeflocke auf ihre ganz eigene Art. Doch das war es nicht, was ihn hinauslockte. Es waren seine Freunde, die sich mit ihm treffen wollten.
„Jumon, da bist du ja“, hörte man eine quietschende Stimme und eine kleine weiße Kugel schwebte Jumon entgegen.
„Psst! Du sollst doch etwas leiser sein, meine Eltern schlafen doch noch“, forderte der 7-jährige Junge.
„Jahaa“, flüsterte das Etwas, „Komm mit, die Anderen warten schon auf dich!“
„Gut gut, zeig mir bitte den Platz, an dem sie mich erwarten!“ Jumon stapfte durch den hohen Schnee und folgte seinem Freund.
Jumons merkwürdige Freunde waren keine gewöhnlichen Freunde, so wie sie jedes Kind hatte. Seine Freunde waren nämlich Geister, die nur er sehen konnte. Die Bewohner seiner Heimatstadt konnten dies gar nicht glauben, als sie den Jungen unter Tags mit der Luft sprechen sahen. Ab und zu jedoch formte sich aus der Luft eine komische Gestalt, die man nur sehen konnte, wenn man in Jumons Nähe war. Auch in dieser Nacht schlich sich Jumon unauffällig aus dem Haus um sich mit seinen Freunden zu treffen. Er war der einzige Junge weit und breit, der mit Geistern reden konnte. Seine Familie beobachtete das schon eine Weile, eher gesagt sein ganzes Leben lang. Darum hatten sie ihm verboten mit diesen Geistern zu reden. Sie hatten nicht nur Angst davor, nein auch die Bewohner beschwerten sich darüber, dass er diese bösen Gestalten fern von der Stadt halten sollte.
Er hatte es bisher wirklich nicht leicht. Immer wurde er von seiner Familie weggesperrt. Seine große Schwester wurde natürlich bevorzugt, weil sie normal war. Jumon selbst verstand die Welt nicht mehr. Was hatten alle gegen ihn, obwohl seine Freunde doch niemandem etwas taten? Und obwohl er doch nur Spaß hatte? Weiter durch den Schnee stapfend, erreichte er, immer noch nur mit einem Pyjama und dem Pullover bekleidet, sein Ziel, eine Lichtung in einem Wald nicht weit von seinem Zuhause entfernt. Die schwebende Kugel flog wild umher, als es einen riesigen alten Geist sah. Dieser hatte einen weißen Flauschebart, eine gigantische Wampe und seine Hände erinnerten an riesige Fäustlinge. Sein Körper war nicht transparent, wie der Körper der kleinen Kugel. Sein Körper bestand zum größten Teil aus Schnee.
„Schön dich wieder zu sehen, Jumon“, begrüßte er den Jungen der sich grinsend vor diesen Giganten hinsetzte.
„Ich hab dich auch schon vermisst, Yofuyuki“, sagte er und umarmte zur Begrüßung den riesigen Daumen seines Geisterfreundes.
Plötzlich erschienen mehrere schneemannartige Geister die herumschwebten und sogar Musik spielten. Jumon genoss es, die Nacht mit seinen singenden und lustigen Freunden zu erleben. Es war wirklich eine tolle Erfahrung die Zeit mit ihnen verbringen zu dürfen.
„Was gibt es denn Neues?“, erkundigte sich Yofuyuki.
„Ich hab wieder mal Hausarrest. Mama hat mich erwischt, als ich mit Ogata gespielt hatte.“
Die kleine weiße Kugel schwebte um Jumons Kopf herum. Bedrückt entschuldigte sich er: „Es tut mir Leid, Jumon. Ich wollte dich wirklich nicht in Schwierigkeiten bringen.“
„Das ist doch schon gut, Ogata. Ist doch nicht deine Schuld. Jetzt mach dir keinen Kopf mehr darüber.“
„Bald werden die Menschen bereit sein, uns zu treffen“, sprach Yofuyuki, „Es braucht nur noch ein wenig Zeit…“
Alle hielten inne, als auf einmal ein großer, weißer Bär, dessen Fell komische Muster trug, auf die Lichtung zugelaufen kam.
„Da bist du ja wieder!“, rief Jumon und rannte auf den Bären zu. Der wuchtige Bär stämmte sich auf zwei Beine und ließ sich dann in den Schnee fallen.
„Kumonji!“, rief Jumon auf, „Was ist mit dir!?“
„Er blutet!“, erkannte Ogata.
Sofort versammelten sich alle Geister um den verwundeten Bären. „Das waren wieder diese Wilderer“, hörte man einen Geist behaupten.
„Sie sind wieder gekommen!“, sagten alle aufgebracht.
„Die machen wir jetzt fertig!“, brüllte Jumon und ballte die Faust, „Einige von euch kümmern sich um Kumonji, der Rest folgt mir!“
„Denkst du wirklich, du schaffst das, Jumon?“, fragte Ogata, „DU hast doch noch nicht genug trainiert.“
„Das ist mir egal“, meinte Jumon schon fast weinerlich, „Die haben Kumonji weh getan, das kann ich nicht durchgehen lassen.“
Jumon zog seinen Pullover und seine Pyjamaoberteil aus und versuchte damit die Verletzungen des Bären zu verbinden. Dann stapfte er halbnackt durch den Wald, hinter ihm ein Haufen von Geistern. Er war in jeder Hinsicht ein besonderer Junge, in solchen Situationen den Mut aufzubringen, sich mit Erwachsenen anzulegen. Die Kälte spürte der Junge kaum. Am Ende des Waldes angekommen, traf Jumon und seine spirituelle Gefolgschaft den zwei Wilderern.
„Verschwindet!“, rief Jumon über den schneebedeckten Platz.
„Was willst du kleiner Jungen denn schon gegen uns tun!?“, gröhlte der etwas größere der Beiden.
„Das wird ein Spaß“, lachte der andere, „Ein kleines Gör will uns wegschicken.“
In Jumon sammelte sich die Wut, als er erkannte, dass neben den beiden ein toter Wolf lag. Es war zu viel für ihn. Erst Kumonji verletzen und dann auch noch einen Wolf umlegen? Jumon schrie auf.
Plötzlich schien es, als ob Jumon schwebte. Doch dann erkannte man, dass sich eine Art Schneehaufen unter seinen Füßen befand, der langsam anfing zu wachsen. Mit einer Handbewegung löste er plötzlich eine Schneewelle, die einer Lawine ähnelte, aus. Die Wilderer waren so erstaunt darüber, was der Kleine für Fähigkeiten hatte, dass sie nur staunend dastehen konnten. Die Schneewelle erwischte die Beiden frontal. Die zwei Männer befreiten sich so schnell sie konnten vom Schnee und standen wieder auf.
„Soll ich noch meine Geisterfreunde bitten, mit euch zu spielen?“, drohte Jumon. Schon in diesem Moment rannten die beiden Wilderer geschockt weg.
„Denen hast du’s gezeigt!“, hörte man Ogata rufen.
„Unser Held!“, beglückwünschten ihn noch andere Geister.
„Ich bin stolz auf dich, Jumon“, meinte Yofuyuki, der plötzlich vor dem orangehaarigen Jungen auftauchte.
„Hoffentlich kommen die nicht wieder“, murmelte Ogata.
„Yofuyuki“, fing Jumon an, „Kann ich wieder nach Hause? Ich bin so müde und trainieren können wir doch noch morgen Abend, oder?“
„Das geht klar“, meinte der gigantische Schneegeist überrascht und trug Jumon nach Hause.
Im Garten setzte er den Jungen ab, der wieder durch das Fenster in sein Zimmer und dann in sein Bett stieg.
„Du bist etwas besonderes“, flüsterte der Riese, kurz nachdem Jumon eingeschlafen war, „Wahre deine Kräfte…“
Am nächsten Morgen wurde Jumon sanft von Sonnenstrahlen, die durch sein Fenster kletterten, geweckt. Er stand auf und erwartete wieder mal den Standardvortrag seiner Eltern. Sie wussten, dass er sich nachts hinaus schlich um sich mit seinen Geisterfreunden zu treffen. Und dafür gab es jedes Mal Ärger. Es war immer das Gleiche: „Wo warst du die Nacht schon wieder? Hast du dich mit diesen Monstern getroffen?“, usw. Er hatte langsam die Schnauze voll. Seine Eltern schrien ihn ja nur noch an und verlängerten seinen Hausarrest. So auch diesen Morgen.Weinend saß er in seinem Zimmer und machte sich Gedanken.
„Ich verschwinde von Zuhause“, sprach er eher zu sich selbst, „Hier hat mich eh keiner lieb. Da bin ich lieber bei meinen Freunden.“
Er packte sich all seine Bücher in eine Tasche, stopfte seine Kleidung noch hinein und kletterte aus dem Fenster. Sofort ging er zu der Lichtung und wartete auf Ogatas erscheinen.
„Ogata! Ogata! Wo bist du?”, rief er umher während er im Schnee saß.
„BUAH!“, piepste eine Stimme hinter Jumon, die ihn anscheinend erschrecken wollte.
„Haha, das ist wirklich lustig!“, lachte der Junge.
„Och manno, nie schaffe ich es, dich zu erschrecken!“, schmollte die kleine weiße Kugel.
„Du wirst es nie schaffen… Wo sind Yofuyuki und die anderen?“
„Die sind im Wald unterwegs und kümmern sich noch ein wenig um Kumonji. Ihn hat’s glücklicherweise nicht zu hart erwischt.“
„Das beruhigt mich.“
„Mich ebenfalls…“
„Du, Ogata…“
„Was ist denn Jumon?“
„Ich bin jetzt von Zuhause weggelaufen… Ich habe keine Lust mehr auf meine Eltern und schon gar nicht auf meine große Schwester!!“
„Das ist doch eine super Neuigkeit! Das müssen wir sofort Yofuyuki erzählen! Komm mit.“
Ogata flog davon und Jumon folgte ihm sofort.An einem kleinen Hang angekommen, trafen sie auf Yofuyuki, der gerade Kumonji behandelte. Jumon und Ogata erzählten Yofuyuki von der anscheinenden guten Neuigkeit. Der weiße Riese machte sich wohl mehrere Gedanken über das abhauen von Zuhause.
„Dann müssen wir dir nun ein hier ein Zuhause bauen, meinst du, du schaffst das?“
„Ja sicher doch!“, meinte Jumon enthusiastisch, „Mit eurer Hilfe schaffe ich das sicherlich.“
Und sie schafften es wirklich. Nach nur wenigen Tagen stand ein kleines Häuschen am Hang für Jumon zur Verfügung.
Seine Eltern suchten nach ihn, doch wirklich zurückhaben wollten sie ihn sicherlich nicht. Das, genauso wie die Verbannung aus der Stadt, wovon Jumon später von seiner besten Freundin Sabî gehört hatte, wunderten ihn nicht. Es war ihm einfach egal geworden. Von Personen die ihn nicht leiden konnten, wollte er erst gar nichts mehr hören. Wichtig für ihn war jetzt nur noch sein neues Leben. Täglich trainierte er mit Yofuyuki, redete mit Sabî, die ihm immer etwas zu Essen brachte und las. Jumon entwickelte sich zu einer richtigen Leseratte. Er konnte sich glücklich schätzen, Sabî als Freundin zu haben. Ihre Familie war die einzige, die geheim noch zu ihm hielt und ihn unterstützte.
 Spezialkapitel T – Zwei Gefühle, eine Tat
Spezialkapitel T – Zwei Gefühle, eine Tat
„… und hier bleibst du!“, hallte es durch einen langen Flur.
„Aber Mama!“, erwiderte ein Mädchen, doch im nächsten Augenblick wurde ihr Rufen durch ein lautes Knallen unterbrochen. Dann verriegelte sich ihr Zimmerschloss.
„Sie kann mich doch nicht schon wieder einsperren“, schmollte das grün-haarige Mädchen, „… dann sind wir mal wieder allein.“
Das Mädchen schlenderte zu ihrem Bett und setzte sich zwischen einen Berg von komisch aussehenden Stofftieren. Nicht nur ihre Stofftiere waren merkwürdig, sondern auch das ganze Zimmer. Ihr Bett stand in einem geöffnetem Schrank, ein Stuhl hatte Puppenbeine und lange blonde Haare, die über die Lehne hingen und der Kronleuchter, der das Zimmer erhellte, war aus Stoff – seine Glühbirnen sahen aus wie Katzenaugen. An der Wand hing eine Uhr in der Form eines Clowns, dessen Schnurrbart die Zeit anzeigten und im Goldfischglas schwamm ein lebendiger Puppenkopf. Es war wirklich ein merkwürdiges Zimmer und ein merkwürdiges Mädchen.
In der folgenden Nacht konnte das Mädchen schlecht schlafen. Es stand auf und ging zur Tür. Überraschenderweise war diese nicht mehr abgeschlossen. „Ich hab Durst …“, murmelte sie vor sich hin und ging zur Küche. Das Mädchen bemerkte, dass in der Küche jemand war und lauschte an der Tür.
„Wir müssen sie wegschicken!“, seufzte ihr Vater.
„Findest du das nicht etwas übertrieben?“, fragte ihre Mutter.
„Ich hab heute schon jemand angerufen und hab mich informiert. Morgen Früh holen sie zwei Lehrer einer Sonderschule ab.“
„Eine Sonderschule?“
„Ja, sie kümmern sich sehr sorgfältig um Tsuru meinten sie. Sie fördern Kinder wie sie, mit besonderen Fähigkeiten.“
„Aber…“
„Glaub mir, das ist die richtige Entscheidung!“
Ihre Mutter seufzte. Dann hörte man, wie sie sich auf einen Stuhl setzte. „Was wird uns das kosten?“, fragte sie.
„Nichts. Sie meinten, sie kümmern sich um die Kinder zum Wohle der Gesellschaft. Außerdem würden sie durch Spendenaktionen unterstützt…“
„Ich weiß wirklich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist!“, wandte die Mutter ein.
„Jetzt hör doch endlich damit auf! Sieh dir doch an, was Tsuru anstellt! Wie sie unser Leben auf den Kopf stellt und wie wir in der ganzen Stadt geächtet werden! Nicht einmal die Nachbarn reden noch mit uns. Hast du es nicht langsam satt?“
Tsurus Mutter konnte nichts mehr sagen. Tsuru schluckte. Ein schwerer Kloß kroch ihr die Kehle hinab in ihre Brust und fühlte sich eigenartig schwer an. Hatte sie richtig gehört? Hatte sie gerade gehört, dass ihre Eltern sie hassen? Sie hassen, weil sie anders war? Tsuru konnte auf einmal nicht mehr klar denken. Dann ging sie in ihr Zimmer zurück und zog sich an.
„Ich will nicht auf so eine doofe Schule!“, schmollte sie, während ein paar Tränen ihre Wange hinunter liefen. Sie schnappte sich die Kekse, die sie unter ihrem Bett versteckt hatte und ihr Lieblingshäschen, das sie liebevoll Kûosa nannte. Dann stieg sie aus ihrem Fenster.
„Ich werde von zu Hause weglaufen!“, nahm sie sich vor und wischte sich mit ihrem Ärmel die letzten Tränen vom Gesicht. Sie wollte einfach weglaufen. Weg von Zuhause. Sie wollte nicht auf so eine doofe Schule. Sie wollte nicht, dass ihre Eltern sie hassen. Sie wollte keine Probleme machen. Tapfer lief sie durch die Dunkelheit der Nacht und kam schon bald zum nahe liegenden Sumpf. Es war feucht und stank. In der Dunkelheit konnte sie schlecht sehen, schaffte aber, einen Pfad zu finden, der nicht vom Schlamm verdreckt war. Ihre Schritte wurden immer leichter. Sie irrte erst ein wenig umher und fand schon bald einen Pfad aus Moos, der sie zu einem trockenen Ort führte. Die Müdigkeit machte sich in Tsuru breit und das Mädchen setzte sich auf den Boden um eine kleine Pause zu machen.
Sie gähnte und lehnte sich etwas zurück. Da war ein Baumstamm, an dem sie sich gemütlich und kuschelig anlehnen konnte. Doch der Baumstamm bewegte sich, als Tsuru diesen berührte.
„Oh, was bist du denn für ein lebendiger Baumstamm?“, wunderte sie sich und stand auf. Mit ihren Händen tastete sie den Stamm ab und merkte, dass es sich um Fell handelte. Sie drückte auf dem Ding herum und kuschelte sich dann an den flauschigen Berg aus Haaren.
„Du bist so weich!“, schwärmte sie und drückte ihr Gesicht noch fester an das Fell. Das Ding schnappte nach Luft. Erst dachte Tsuru, dass es lachen würde, weil sie es kitzle, doch dann erkannte sie, dass es hustete. „Was ist denn mit mir los? Bist du etwa krank?“
Das Ding drehte sich auf die andere Seite.
„Du bist ja ein Bär!“
Der Bär schnaufte und hustete ab und zu. Tsuru tat so, als würde sie bei ihm Fieber messen und kündete dann stolz ihr Ergebnis fest, als ob sie eine Doktorin wäre: „Fieber hast du keins… Hast du Hunger? Willst du was essen?“
In dem Moment glitzerten die Augen des Bären und Tsuru kramte aus ihrer Tasche einige Kekse. „Hier kannst du etwas haben.“
Sie schob dem Bären einen Keks nach dem anderen in den Mund. Er kaute genüsslich darauf herum und weinte vor Glück.
„Du bist ja ein lieber Bär!“, lachte sie und der Bär lachte mit. Tsuru setzte sich neben den Bären und streichelte seinen Kopf. Irgendwann schlief sie dabei ein.
Am nächsten Morgen wachte Tsuru auf. Sie tastete neben sich um den Bären zu spüren. Doch er war nicht mehr da. Allmählich machte sie die Augen auf und nachdem sie einmal herzhaft gähnte, erkannte sie zwei Schatten. Es waren zwei Männer in schwarzen Mänteln.
„Bist du Tsuru Gappei?“, fragte sie einer der Männer.
„Ja… was…?“, antwortete sie.
„Das ist sie also“, erkannte der Andere.
Beide der Männer trugen lange schwarze Mäntel und Kapuzen, wodurch ihre Gesichter nicht zu erkennen waren. „Wir sind hier um dich abzuholen.“
„Lasst mich! Ich gehe nicht mit euch! Und ich gehe nicht nach Hause!“, brüllte Tsuru und stand auf.
Doch der Mann mit der tieferen Stimme packte sie am Arm und ließ sie nicht mehr los.
„Lass los!“, schrie sie.
„Die Handschellen“, sagte der eine und der andere holte sie aus seiner Tasche heraus. Er versuchte sie Tsuru anzulegen, doch diese biss ihm in die Hand.
„Du kleines Balg! Wirst du still sein und mitkommen! Autsch!“, beschwerte sich der Mann in schwarz.
„Ich habe gesagt, ich werde nicht mitkommen!“, schrie sie noch lauter.
„Jetzt reicht es mir!“, meinte der Kerl, der sie festhielt, schnappte sich die Handschellen und legte sie der Kleinen an.
„NEIN!“, schrie Tsuru und ihr Echo hallte durch den Wald.
Plötzlich leuchteten ihre Hände, sie aktivierte ihre Kräfte. In jenem Augenblick hörte man ein lautes Schnaufen und dann fühlte man ein starkes Beben. Ehe sich die Männer versehen konnten, wurde sie schon von einem riesigen Bären nieder gestoßen und die Attacke, die sich eigentlich gegen ihre Angreifer richtete, traf den unschuldigen Bären. Die Männer die im Dreck lagen, wurden Zeuge eines besonderen Schauspiels. Das Licht umhüllte den Bären, der nun über dem Boden zu schweben schien. Neben ihm schwebte Kûosa, Tsurus rosa farbenes Lieblingshäschen. Die Lichtfluten brachten nun auch die Körper zum Leuchten. Es war so grell, dass die Männer sich die Hände vor die Augen halten mussten, um nicht geblendet zu werden.
Es war still. Der Nebel kroch langsam die Lichtung hinauf und tauchte die Szene in eine düstere Atmosphäre. Die Männer in schwarz standen auf und klopften sich den Dreck von der Kleidung.
„Dieses Balg!“, beschwerte sich der eine.
„Endlich habe ich ihre Fähigkeit miterlebt, bemerkenswert“, sagte der andere.
„Sie wird uns behilflich sei…. n…“, verstummte der Mann, als er erkannte, was sich vor ihm auftat. Ein gut drei Meter großes Monster richtete sich aus dem Nebel auf. Sein Schnaufen ließ die Körper der Männer erzittern. Es hob seine Pranke und schlug die Männer zu Boden. Sie standen nicht mehr auf. Danach trug das Monster das Mädchen weg vom Schauplatz. An einer anderen Lichtung setzte er sie wieder ab und deutete mit seinen Krallen auf einen Korb voller Essen.
Tsuru schaute sich das Monster genauer an und erkannte, dass sie mit ihrer Fähigkeit Kûosa, ihr Lieblingshäschen und den Bären, den sie mit Keksen fütterte, vereinigt hatte. Das Monster lächelte sie an und deutete wieder auf den Korb mit Essen.
„Hast du… Hast du mir das Essen geholt?“, fragte sie ihn. Sie bekam ein Nicken zur Antwort. „Willst du mein Freund sein?“
Das Monster legte das breiteste Grinsen auf, das es drauf hatte.
„Dann heißt du jetzt Kûosa!“, lachte sie und Kûosa nahm sie in seine Arme und knuddelte sie. Das Mädchen und das Monster aßen zusammen. Nach einiger Zeit gingen sie weiter. Es war zu unsicher und sie wollten nicht noch einmal von den Männern in schwarz gefunden werden. Jedoch trafen sie bald auf eine Gruppe junger Menschen, der sie sich dann anschlossen.
 Spezialkapitel M – Pfad der Freundschaft
Spezialkapitel M – Pfad der Freundschaft
Es war ein altes Dorf in den Ruinen einer Wüste, über dem sich die Wolken zusammen taten und in einer grauen, flauschigen Masse den sonst strahlend blauen Himmel bedeckten. Ein Donnergrollen kündigte den ersten Regen seit den letzten Monaten an. Der Regen prasselte nur so auf den sandigen Boden und spülte den Dreck weg. Er spülte den Dreck der Straßen, Pfade und Häuser des Dorfes weg. Hier und da sprossen die Blumen und etwas Gras wuchs in Windeseile. Das uralte Dorf erweckte wieder zu neuem Leben.
„Matra…“, flüsterte eine Frau mit glänzend schwarzen Haaren, die sich über ihre Tochter beugte, „Matra, wach auf, es ist so weit…“
Sanft berührte sie ihre Tochter an der Schulter. Sie ruckelte nicht an ihr.
„Matra, es ist so weit“, wiederholte sie leise ihre Worte, „Hörst du den Regen?“
Die kleine Matra kam zu sich. „Der Regen…?“, murmelte sie und richtete sich auf.
„Guten Morgen mein Schatz“, begrüßte sie ihre Mutter mit einem liebevollem Lächeln und strich ihr durch das kurze Haar, „Hast du gut geschlafen?“
„Ja, das habe ich“, lächelte Matra, „Ich habe wieder von ihnen geträumt!“
„Hast du? Was war es diesmal denn?“, wollte ihre Mutter wissen.
„Heute haben sie ein wunderschönes Mädchen gerettet, die von bösen Leuten gefangen gehalten wurde…“
„Wurde jemand verletzt?“
„Nein, alle sind Heil aus dem Schlamassel raus gekommen!“
„Das ist ja klasse“, fand ihre Mutter, „Aber jetzt komm, frühstücke schnell noch etwas und dann mach dich fertig, heute ist der große Tag…“
„Geht klar“, grinste Matra und sprang aus ihrem Bett. Die Mutter ging aus dem Zimmer in Richtung Essraum. Barfüßig lief die kleine Matra über den erdigen Boden und merkte schnell, dass der Regen den Boden schnell abkühlte. Zuerst war es noch ein wenig ungewohnt und unangenehm, doch schnell genoss sie es, nicht auf einem zu warmen Boden laufen zu müssen. Matra machte sich fertig, zog sich an und setzte sich dann ebenfalls in das Esszimmer, in dem sie schon von ihrer Mutter erwartet wurde.
„Wo ist Papa?“, fragte die Kleine.
„Er ist mit den anderen Männern der Stadt auf die Hügel gegangen. Durch den Regen wachsen jetzt doch wieder die Pflanzen und sie kümmern sich alle darum, damit wir auch in nächster Zeit reichlich an Essen haben…“
„Stimmt“, merkte Matra und setzte sich hin. Sie nahm sich ein Brot und biss einen riesigen Brocken ab.
„Nimm nicht so viel Schatz, sonst verschluckst du dich noch…“
„Iff dof nüf!“, prahlte Matra und verschluckte sich dann an diesem Stück Brot. Doch nach etwas Husten war sie wieder gerettet.
Dann nahm Matra einen kleineren Bissen. Sie hatte wohl aus ihren Fehlern gelernt. Doch auch das hielt sie nicht davon ab sich zu verschlucken, denn hinter ihr stand plötzlich ein anderes Mädchen und erschreckte sie zu Tode.
„Hab dich!“, rief das Mädchen.
„AH!“, schrie Matra und hüpfte richtig auf.
„Du bist heute aber mal wieder schreckhaft“, lachte das Mädchen hinter ihr.
„Guten Morgen Uwanari“, grinste die Mutter, „Bist du schon fertig?“
„Ja“, antwortete sie, „Meine Eltern haben mich heute schon früh geweckt!“
„Guten Morgen Uwanari…“, brummte Matra die sich wieder normal hinsetzte, „Musst du mich jedes Mal so begrüßen?“
Man merkte Matra an, dass es ihr keinesfalls gefiel.
„Wir sind doch immerhin Freundinnen, da darf man sich doch mal einen Spaß erlauben!“, lachte sie.
„Aber das machst du jedes Mal…“, seufzte sie und aß ihr Brot zu ende.
„Tjapp, wenn du so schreckhaft bist“, wehrte sich Uwanari, „Bist du endlich soweit? Ich kann es kaum noch erwarten!“
„Jetzt bin ich so weit“, meinte sie und schluckte ihren letzten Bissen runter.
„Na dann, geht’s los“, meinte ihre Mutter, stand auf und klopfte sich noch die Brösel von ihrer Schürze.
„Beeilt auch mal! Es warten bestimmt schon alle“, forderte Uwanari, die schon an der Tür stand.
„Nicht so hektisch, ich bin schließlich auch nicht mehr die Jüngste“, sagte Matras Mutter. Dann gingen sie zum Tempel.
Es hatte nicht aufgehört zu regnen. Der Boden war schlammig geworden, doch anscheinend störte das keinen im Dorf. Andere Kinder tollten durch die Straßen und alte Frauen saßen auf Stühlen und genossen es, wie der Regen auf ihre Haut fiel. Es war der erste Regen seit langem. Nicht nur die Menschen profitierten davon, sondern auch die Tiere der Umgebung und natürlich auch die Pflanzen. Der Regen war für dieses kleine Volk eines der heiligsten Naturphänomene, die es kannte. Wenn eine der Priesterinnen des Tempels, den sie bewachten, ihrer Bestimmung nicht mehr nachgehen konnte oder verstarb, war es Brauch gewesen, beim ersten Regen des Jahres alle Mädchen der Stadt zu versammeln und die nächste Priesterin zu bestimmen. Der Oberpriester hielt eine Art Ritual, eher eine Zeremonie ab, in der er bestimmte, welche Mädchen als Anwärterinnen für das Priesterinnenamt in Frage kommen. Uwanari, Matra und ihre Mutter saßen sich in den Tempel und der Priester hielt die Zeremonie ab. Gespannt warteten die Mädchen des Dorfes auf die Zeremonie.
„Sei nicht enttäuscht“, grinste Uwanari, „wenn du keine Auserwählte wirst, ich werde dann dafür das alles doppelt so gut machen, ja?“
Uwanari war sehr überzeugt von sich. Während ihres Ego-Höhenflugs merkte sie aber nicht, wie aufgeregt und nervös Matra eigentlich war.
„Geht klar“, nuschelte sie und Uwanari strahlte.
‚Wenn ich es nicht schaffe, ist es ja nicht so schlimm…‘, redete sich Matra ständig ein. Eine Priesterin zu sein, war für die jungen Mädchen aber etwas sehr Tolles. Denn das würde bedeuten, dass man sich nicht unbedingt um die Landwirtschaft und um das Haus kümmern muss. Es würde bedeuten, dass man von den meisten Leuten der Stadt respektiert wird und dass man der Stadt und dem Tempel etwas Gutes tun konnte. Deswegen setzte sich Matra so unter Druck und war so nervös. Sie wollte doch so gern Priesterin werden, zusammen mit Uwanari, ihrer besten Freundin. Sie wollte so gern etwas Gutes für ihr Dorf tun.
Dann war es soweit. Der Oberpriester sprach die entscheidenden Worte und bat die Mädchen zu sich nach vorne. Sie stellten sich in einem Kreis auf und der Priester lies etwas Staub des Heiligtums des Tempels auf den Boden fallen. Wie als würden Wind oder Magnetismus den Staub manipulieren, bewegte sich der Staub von allein in die Richtung zweier Mädchen, die nebeneinander standen. Prüfend blickte der Priester die Mädchen an. Enttäuschung und teils auch Freude ging durch die Reihen der Mädchen. Es schien, als wäre eine Entscheidung getroffen. Dann verkündete er das Ergebnis: „Wie es scheint, hätte das Heiligtum seine Anwärterinnen ausgewählt! Dieses Mal sind es zwei junge Mädchen, die anscheinend geeignet dafür sind, sich auf das Priesterinnenamt vorzubereiten. Ihr Zwei, nennt mir eure Namen…“
Eigentlich kannte der Priester die Namen der Mädchen, aber anscheinend gehörte dies zur Zeremonie.
„Uwanari!“, sagte das eine Mädchen.
„Matra“, brachte Matra kaum aus sich heraus, so nervös war ich. Sie blickte schnell zu ihrer Mutter, die noch auf der Bank saß. Sie lächelte sie an und freute sich für ihre Tochter. Dann schaute Matra wieder den Priester an.
„Seid ihr bereit dafür, Anwärterinnen für das Amt der heiligen Priesterin dieses Tempels zu werden?“
„Ja!“, antwortete Uwanari und strahlte wie sie nur konnte.
„Ja…“, murmelte Matra.
„Ihr wisst, dass am Ende nur eine von euch Priesterin wird? Ist euch das bewusst?“
„Natürlich!“, antwortete Uwanari mal wieder zuerst.
Matra sah unsicher ihre Freundin an. Sie sollten zusammen Anwärterinnen werden? Sie sollte sich mit ihrer besten Freundin…. Anscheinend war es so. Wenn das Heiligtum es so bestimmte, blieb ihr wohl nichts anderes übrig.
„Natürlich“, antwortete auch sie.
„Die Entscheidung ist gefällt, die Zeremonie vorbei. Ihr Mädchen könnt nun nach Hause gehen… Matra, Uwanari, ich sehe euch morgen Früh wieder…“ So verabschiedete sich der Priester.
„Mama…“, nuschelte Matra und rannte in die Arme ihrer Mutter. Sie strich ihrer Tochter durchs kurze Haar. „Freu dich doch, Schatz.“
„Das tue ich doch“, murmelte sie durch die Schürze, gegen die sie ihr Gesicht presste. Matra freute sich unbändig. Sie konnte mit ihrer besten Freundin nun Anwärterin werden. Einer ihrer größten Träume, hatte sich somit erfüllt.
 Spezialkapitel D – Verletzte Schwingen, auf zur Rettung
Spezialkapitel D – Verletzte Schwingen, auf zur Rettung
Es war ein kühler Frühlingsmorgen, als ein Junge mit hellbraunem Haar sich aus seinem Bett quälte.
„Und schon wieder ein einzigartiger Morgen“, murmelte der Junge, stand auf und ging ins Bad. Gähnend betrachtete er sein Spiegelbild.
„Was mach ich heute nur?“, fragte er sich und putzte sich die Zähne. Als er damit fertig war, ging er zurück in sein Zimmer und hockte sich auf sein Bett. Sein Zimmer war strahlend weiß. Es sah aus, als wäre es frisch gestrichen worden. Vielleicht lag dieser Eindruck auch nur daran, dass durch das große Fenster eine Menge Licht in den Raum hineinströmen konnte. In seinem Zimmer stand ein riesiger Schrank. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich einige Magazine und Hefte. Gegenüber davon stand ein Regal mit einigen Büchern. Sein Bett befand sich direkt neben dem großen Fenster. Ein riesiges Plüschtier lag neben dem Bett auf dem Boden.
„Du sollst doch nicht immer runterfallen“, sagte der Junge und lag das Plüschtier wieder auf seinen richtigen Platz. Da bemerkte er, dass die Schublade unter seinem Bett offen stand. Einige Heftchen ragten aus dem Spalt. Dann hörte er stimmen, schnell stopfte er die Hefte in die Schublade und schob sie noch rechtzeitig zu, bevor die Tür geöffnet wurde.
„Guten Morgen, Sohn“, meinte ein Mann, der wohl Mitte vierzig war.
„Morgen Paps“, antwortete ihm sein Sohn.
„Kommst du zum Frühstück?“, bat sein Vater und ging wieder.
„Klar, ich zieh mich noch schnell an!“, rief er ihm hinterher, als er zur Tür stürmte um sie wieder zu schließen.
„Zum Glück hat er mich nicht erwischt“, sagte der Junge und seufzte. Er ließ sich nieder und streckte sich noch einmal. Es war nicht einfach, der Sohn des Bürgermeisters zu sein. Auch wenn sein Vater nicht viel sagte, geschweige denn viel von ihm verlangte, fühlte sich der Junge unter Druck gesetzt. Es war, als hätte sein Vater eine einschüchternde Aura. Aber daran wollte er jetzt nicht denken. So stand er wieder auf, um sich seine Kleidung aus dem Schrank zu holen. Was wollte er anziehen? Er hatte schon eine Idee!
Tief hinter seinen normalen, sauberen Klamotten kramte er etwas ganz Besonderes heraus. Bei dem, was er heute tragen wollte, handelte es sich um ein gelbes, dreckiges und zerrissenes Unterhemd und eine abgenutzte alte Lederjacke. Dazu noch graue Shorts, das war das perfekte Outfit!
„So kann ich heute wieder Nacho besuchen gehen“, grinste der Junge und ging in die Küche. Dann setzte er sich an den Küchentisch zu seinen vier Schwestern. Sie alle waren älter als er gewesen. Von klein auf war er es schon gewohnt gewesen, dass seine Schwestern mit ihm spielten und ihn ärgerten, wie sie nur konnten.
„Na, was machst du heute?“, wollte die Jüngste von ihnen wissen und wuschelte ihm durchs Haar.
„Lass das!“, wehrte er sich und stieß ihre Hand weg, „Ich geh spielen…“
„Doch nicht schon wieder mit diesem Jungen“, meinte die älteste Schwester.
„Was habt ihr nur gegen Nacho?“, wunderte er sich und stopfte sich Toast in den Mund.
„Du weißt doch, dass Vater was dagegen hat!“, meinte die Schwester, die gerade durch die Zeitung blätterte.
„Dass ich gegen was etwas dagegen habe?“, meinte plötzlich der Vater, der mit der Aktentasche in den Raum kam. Er blickte seinen Sohn an und wusste schon was los war.
„Oh oh…“, meinte Denji nur und sprang auf.
„Du gehst doch nicht schon wieder zu diesem Bettlersjungen!?“, brüllte sein Vater durch den Raum, doch der Junge war schon verschwunden, „Denji! Komm zurück!“
„Ach Schatz… Lass den Jungen doch spielen, er ist erst dreizehn geworden. Lass ihn doch sein Leben leben“, wollte ihn seine Frau besänftigen.
Denji schlenderte durch die Straßen. Er verstand einfach nicht, was für ein Problem sein Vater mit diesen Leuten hatte. Sie waren auch doch auch Menschen! Aber seinem Vater ging es anscheinend sowieso nur ums Geld. Nur wer Geld hatte, sollte ihn wählen und nur wer Geld hatte, konnte dann auch für die Stadt zahlen. Es war immer dasselbe mit seinem Vater. Vielleicht ging Denji auch deswegen, rein aus Trotz, immer wieder in die Armenviertel der Stadt um seinen besten Freund Nacho zu besuchen. Genau wie er es heute auch tat. Er genoss es, durch die Straßen zu schlendern. An der Ecke mit der Bäckerei in eine kleine Gasse einzubiegen und dann durch ein verworrenes Labyrinth von kleinen, dunklen Gassen dann zu einem Hinterhof zu gelangen. Dort lag er schon im Schatten und hielt wohl ein Nickerchen, sein bester Freund Nacho.
„Hey…“, begrüßte er seinen Freund, kniete sich vor ihn hin und stupste ihn mit dem Zeigefinger in den Magen, „Hey… wach auf!“
Nacho zuckte auf, öffnete seine Augen und erblickte Denji, der grinsend neben ihm saß.
„Wie… wie geht es dir?“, fragte Nacho und gähnte noch einmal herzhaft.
„Ach, ganz okay, wollen wir heute was unternehmen?“, grinste Denji wieder. Er wusste, dass sein Freund diesem Grinsen nicht widerstehen konnte.
„Klar, was willst du machen?“, meinte Nacho und stand auf. Er öffnete eine Tür, deren grüner Lack schon abblätterte und sagte seiner Mutter, dass er mit Denji etwas unterwegs sei. Dann liefen die Freunde gemeinsam durch die Gegend.
„Ich hab davon gehört, dass die Baustelle in der Nähe vom Geisterhaus geschlossen wurde. Wegen komischen Ereignissen haben die Bauarbeiter das Bauen aufgehört! Ich habe das Gefühl, dass das mit dem Geist zu tun hat, das muss ich einfach untersuchen!“
„Meinst du? Na gut“, meinte Nacho und verschränkte die Arme hinter seinem Kopf.
„Ist bei dir alles in Ordnung?“, hakte Denji nach.
Er wusste, dass Nachos Familie Probleme mit dem Geld hatte. Es gab Tage, da hatten sie nicht einmal was zu Essen gehabt. Deswegen brachte Denji ab und zu etwas zu Essen von Zuhause mit.
„Es geht schon. Dad hat letztens für ein paar Tage in einem Restaurant ausgeholfen, das Geld was er verdient hat, reicht noch etwas“, erklärte Nacho, als wäre dies etwas ganz Normales gewesen.
Die Jungs ließen sich Zeit und gingen noch einmal gemeinsam durch die Stadt. Sie mochten es, die Leute zu beobachten und sich Zeit zu lassen. Dadurch konnten beide einmal an etwas anderes denken, als immer an die Probleme von Zuhause. Das mochte Denji an Nacho auch so sehr. Durch ihn konnte er alles andere einfach vergessen. Nur merkte er nach einiger Zeit, dass er nicht nur alles andere vergessen konnte, sondern auch, dass er nur noch an ihn denken musste. Anfangs konnte Denji dieses Gefühl, das er in sich spürte, nicht wirklich zuordnen. Aber dann merkte er langsam, dass er Nacho nicht nur als Freund betrachtete. Einerseits faszinierte ihn Nachos Freiheit. Die Freiheit die Denji so nie hatte, da er von seiner Familie so unter Druck gesetzt wurde. Andererseits war es auch seine Willensstärke, die Denji wie eine riesige Welle einnahm. Obwohl Nacho so viele Probleme hatte, gab er nie auf zu kämpfen, egal was kommen würde. Zuletzt merkte Denji, dass er seine dunklen Haare mochte und seine von der Sonne gebräunten Haut.
„… Denji… Denji?“, wunderte sich Nacho und winkte mit seiner Hand vor seinem Gesicht herum, „Träumst du schon wieder?“
Denji atmete geschockt auf.
„Oh… ja…“, stotterte er während er tief in die dunklen Augen seines Freundes blickte.
„Wir sind da“, bemerkte Nacho und betrachtete die Baustelle, „Die steht ja echt leer.“
„Meinte ich doch! Wollen wir sie untersuchen?“
„Klar“, sagte Nacho und folgte seinem Freund.
Sie liefen ein wenig umher, nahmen die Baugeräte unter die Lupe und untersuchten erst einmal die Lage. Anscheinend hatte ein Bagger den Zaun zum nebenstehenden Grundstück zerstört, auf dem das von den Kindern gefürchtete Geisterhaus stand. Die Kinder munkelten, dass dort ein Mann lebte, obwohl das Haus schon seit Jahren leer stand. Einige Kinder behaupteten sogar, dass ab und an ein Postbote vorbeikommen würde um Briefe abzugeben. Wegen diesem Grund, war es auch eine beliebte Mutprobe für die Kinder gewesen, dort hineinzugehen und alle Räume abzuklappern. Die Mädchen trauten sich nie, das wusste Denji. Selbst die stärksten Jungs trauten sich manchmal nicht, dabei verstand er nicht, was so gruselig dabei war. Er selbst war schon einige Male dort drin gewesen und konnte nichts Gruseliges ausfindig machen. Aber irgendwo musste doch etwas Wahres an der Geistergeschichte sein, oder? Daran glaubte er ganz fest.
„Lass uns nach oben gehen!“, forderte Denji und zerrte Nacho mit zum Eingang. Nun, Eingang konnte man das nun wirklich nicht nennen. Das Haus hatte kaum eine Fassade. So gingen die beiden Jungs die Treppen nach oben. Bis zum dritten Stock gab es schon einen Boden. Ab dem vierten Stock lagen nur alte Holzbretter auf den Stahlbalken. Doch Denji wollte noch weiter hinauf, in den fünften Stock. Dort sollten einige Bauarbeiter den Geist gesehen haben.
„Ist es hier nicht zu gefährlich?“, meinte Nacho, dem das Ganze nicht ganz geheuer war.
„Aber wenn hier doch der Geist sein soll!“, wandte Denji ein und lief etwas herum.
„Du hast in dem Geisterhaus doch auch nie diesen Geist gesehen!“, beschwerte sich Nacho und wollte schon wieder zurückgehen.
Doch dann passierte es. Nacho trat auf ein morsches Brett und es krachte ein. Die nebenstehenden Bretter verloren ihren Halt und so viel Nacho hinab. Er versuchte sich noch irgendwo festzuhalten, aber er konnte nicht, da sein Arm so schnell gegen den Stahlträger geschleudert wurde, sodass er auf einmal taub war.
„Denji!“, rief er im selben Augenblick.
Ein Glück, dass Denji seit längerem schon Kampfunterricht genommen hatte, weswegen er so schnelle Reflexe hatte, dass er zum Loch sprintete und Nacho gerade noch so an einem Arm festhalten konnte.
„Ich hab doch gesagt es ist gefährlich!“, brüllte Nacho der sich mit voller Kraft an Denjis Ärmel festhielt.
„Arg… du bist so schwer!“, schrie Denji, aus dessen Hände Nachos Arm langsam zu gleiten drohte, „Gib mir deinen zweiten Arm, dann zieh ich dich hoch!“
Denji klemmte sich mit seinen Beinen stark an den Stahlbalken. Er zitterte vor Anstrenung.
„Ich… ich kann nicht“, meinte Nacho leise.
„Das… das sehe ich!“, unterbrach ihn Denji mit nervöser Stimme, „Egal was ist, schau nur nicht nach unten!“
„Ich spüre meinen Arm nicht mehr…“, murmelte Nacho und war kurz davor nach unten zu sehen.
„Das ist kein Wunder, dein Arm ist voller Blut“, erklärte Denji, der Nachos Arm nun viel fester packte. Mit all seiner Kraft versuchte er seinen Freund nach oben zu ziehen. Denji brüllte und strengte sich noch viel mehr an.
„Denji… ich…“, murmelte Nacho vor sich hin, der auf einmal viel blasser im Gesicht wurde. Denji zog und zog und schaffte es, dass Nacho mit dem Oberkörper nun wieder auf den Brettern lag. Dann packte er ihn an seiner Hose und zog ihn komplett nach oben.
„Wir sollten ins Krankenhaus“, meinte Denji voller Panik. Er ging mit Nacho einige Schritte zurück, wo der Boden stabiler war. Nacho sackte in die Knie. Während er vor Schwindelgefühlen nach hinten fiel, stieß er einen Stapel Kisten um, auf denen schwere Rohre lagen. Einer davon fiel Nacho auf den verletzten Arm. Dieser brüllte so laut er nur konnte.
„Oh verdammt!“, schrie Denji und hob mit aller Kraft das schwere Rohr von seinem Arm, „Nacho, Nacho… ist alles in Ordnung!?“
Kurz bevor er das Rohr beiseite brachte, glitt es ihm aus seinen schwitzenden Händen und es landete wieder auf der Verletzung. Nacho antwortete nicht. Er hatte sein Bewusstsein verloren. Mit aller Kraft brachte Denji das Rohr endlich beiseite.
„Verdammt“, brüllte Denji und zog Nacho auf seinen Rücken. Er schlenderte die Treppen hinab und erreichte dann bald die Straße. Mit dem bewusstlosen Nacho auf seinem Rücken, machte er sich auf den Weg zu einem Arzt. Nach nicht allzu langer Zeit trafen sie dann auf einen Mann, der die Jungs bemerkte. Dann schien es für Denji alles wie in sekundenschnelle abzulaufen. Der Mann erkundigte sich nach dem verletzten Nacho, trug ihn auf seinen Armen und stürmte mit Denji zum nächsten Arzt. Beim Arzt angekommen, wurde der Verletzte gleich versorgt. Denji musste die ganze Zeit im Wartezimmer warten. Es war schrecklich. Tränen strömten unaufhörlich über sein Gesicht.
Nach einiger Zeit durfte Denji dann in das Krankenzimmer. Dort saß Nacho in einem Bett, mit einem dicken Verband um seine Brust gewickelt.
„Nacho…“, meinte Denji vorsichtig, „Wie geht es dir?“
Nacho wandte seinen Kopf beiseite und betrachtete die Sonne, die schon auf ihrem Sinkflug war. Er seufzte.
„Geht schon…“, sagte er schwach.
„Es tut mir Leid, wir hätten nicht dort hinauf gehen sollen“, entschuldigte sich Denji, der sich die Schuld für den Unfall gab.
„Wenn es dich nicht stört, würde ich gerne etwas schlafen“, bat Nacho, lag sich hin und schloss seine Augen.
„Kein Problem“, meinte Denji. Doch es war ein Problem. Es tat ihm so schrecklich Leid. Denji wollte doch nur, dass alles wieder in Ordnung zwischen den beiden sei. Doch irgendwie merkte er, dass Nacho noch etwas länger auf ihn sauer sein würde.
Er wartete, bis sein Freund endlich eingeschlafen war. Vorsichtig ging er zu seinem Bett und betrachtete den schlafenden Nacho.
„Es tut mir wirklich Leid“, flüsterte Denji und legte seinen Kopf auf seine Brust. Still flossen weitere Tränen. Doch er merkte, dass etwas komisch war. Vorsichtig tastete er Nachos Oberkörper ab und merkte, dass etwas anders war. Als er sich wieder aufrichtete, entdeckte er, dass Nacho ein Arm fehlte. Geschockt schluckte er einige Tränen. In diesem Augenblick kam der Arzt herein.
„Was ist mit ihm passiert?“, hakte Denji sofort nach.
„Sein Arm hatte zahlreiche, irreparable Verletzungen, wir mussten ihn abnehmen“, erklärte der Arzt, „Könntest du mir einen Gefallen tun?“
Der Arzt war nett. Er wuschelte den weinenden Denji tröstend durchs Haar.
„Du musst jetzt stark sein, ja? Tu es für ihn“, meinte der Arzt und legte ein Brett, an das einige Blätter geklemmt waren beiseite, „Könntest du seinen Eltern Bescheid geben? Das wäre sehr wichtig.“
Denji merkte, dass ihm nichts anderes übrig blieb. Außerdem war es das Einzige, was er momentan tun konnte. Er nickte. Der Arzt verstand und ging aus dem Raum. So blieb Denji noch ein kurzen Augenblick. Er beugte sich wieder zu Nacho und sprach zu ihm: „Ich gehe schnell zu deinen Eltern, ja? Du kommst bestimmt allein zurecht…“
Er schniefte und wischte sich einige Tränen aus dem Gesicht. Dann setzte er wieder sein Lächeln auf.
„Ich liebe dich, Nacho“, flüsterte er und küsste ihn sanft auf seine Lippen, „Das wollte ich dir schon immer einmal sagen.“
Still machte er sich dann auf den Weg um Nachos Eltern die Nachricht zu überbringen. Irgendwie spürte Denji, dass er nun nicht mehr gebraucht werden würde. Deswegen schlenderte er im Sonnenuntergang nach Hause.